Update!
Wir haben uns mit den Rechtsanwälten Malte Brix und Björn-Michael Lange zur
zusammengeschlossen!
Unsere neue Website finden Sie unter www.vy-anwalt.de.
Telefonisch sind wir weiterhin unter der Nummer +49 30 51565998-0 zu erreichen.
Neu sind unsere Email-Adressen:
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Rechtsanwalt Malte Brix und Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Björn-Michael Lange haben ihre Schwerpunkte im
und ergänzen damit unsere Schwerpunkte im
sodass wir künftig alle Bereichen des Unternehmens-Wirtschaftsrechts abdecken und für kleine und mittelständische Unternehmen umfassend als externe Rechtsberatung und Vertretung agieren können.
Unsere langjährige Office-Managerin Leonore Baartz steht weiterhin in allen organisatorischen Fragen, bei der Anmeldung und Verwaltung von deutschen, europäischen und internationalen Marken und Kennzeichen, bei Inkasso, Forderungsmanagement und Buchhaltung sowie der Zwangsvollstreckung zur Verfügung!
Sitz der Partnerschaft ist Berlin, an der bekannten Adresse Vy, Rudi-Dutschke-Straße 23 (betahaus), 10969 Berlin, Germany. In Koblenz und Kiel besteht eine Zweigniederlassung und im betahaus Hamburg verfügen wir über Arbeits- und Meetingräume
Erneut wurden wir von The Legal 500, Deutschland 2023 für die Bereiche Medien & Entertainment als "Führenden Kanzlei" und als führend für "Urheberrechtliche Streitigkeiten" (als eine von insg. nur acht Kanzleien in Deutschland!) ausgezeichnet — dafür danken wir allen Mandanten und Kollegen! >> Aus der Beschreibung: Vy Verweyen Vy Verweyen ist eine auf Datenschutz, Urheberrecht, IT und Markenrecht spezialisierte Einheit, die Unternehmen, Kreative, Agenturen und Verwerter sowie Start-ups zu medien-, wettbewerbs- sowie telekommunikationsrechtlichen Fragen berät; das Expertisenportfolio umfasst hierbei ebenso Urheberrecht, E-Commerce, Marketing und Compliance. Urs Verweyen hat umfassende Erfahrung in der Prozessvertretung. Praxisleiter: Urs Verweyen Referenzen 'Die Zusammenarbeit ist sehr persönlich, digital und direkt. Die Reaktionszeiten sind sehr kurz und wir fühlen uns sehr gut betreut.' 'Urs Verweyen zeichnet sich durch ein hohes Maß an Genauigkeit bei der Erstellung und Prüfung unserer Verträge aus. Er kennt unsere Bedürfnisse und schlägt entsprechend passende Vereinbarungen vor. Durch sehr kurze Reaktionszeiten können wir dadurch im Wettbewerb sehr gut agieren.' 'Es läuft wie am Schnürchen, Infos gehen nicht verloren, jeder ist immer im Bilde.' Über The Legal 500 The Legal 500 wird seit 36 Jahren veröffentlicht und ist weitgehend als das weltweit umfassendste juristische Handbuch anerkannt. Über 300.000 Inhouse-Juristen und -Juristinnen weltweit werden jedes Jahr von uns befragt und interviewt. The Legal 500 ist ein unabhängiges Handbuch, d.h. Kanzleien sowie Anwälte bzw. Anwältinnen werden von uns ausschließlich aufgrund ihrer Leistung empfohlen. Es ist das einzige Handbuch, das den Bedürfnissen von Inhouse-Juristen und -Juristinnen nach einer fokussierten Darstellung der Stärke und Kenntnistiefe des Teams (der Praxis und Associates), d.h. nicht nur der reinen Auflistung individueller Partner und Partnerinnen, gerecht wird.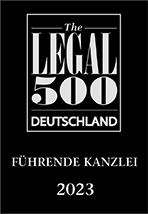
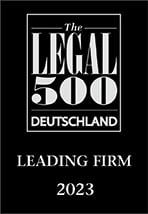
Mit Urteil vom 8. Dezember 2022 hat der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-460/20 entschieden, dass der Betreiber einer Suchmaschine Suchergebnisse auslisten muss, wenn der Antragsteller nachweist, dass diese offensichtlich unrichtig sind. Nicht erforderlich ist, dass der Betroffene zuvor gerichtlich gegen den Betreiber der Website mit der Falschinformation vorgeht. Der Suchmaschinen-Betreiber ist hingegen nicht verpflichtet, bei der Suche nach Tatsachen, die von dem Auslistungsantrag nicht gestützt werden, aktiv mitzuwirken: >> Gerichtshof der Europäischen Union, Pressemitteilung Nr.197/20, Luxemburg, den 8. Dezember 2022 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden"): Der Betreiber einer Suchmaschine muss die in dem aufgelisteten Inhalt enthaltenen Informationen auslisten, wenn der Antragsteller nachweist, dass sie offensichtlich unrichtig sind Allerdings ist es nicht erforderlich, dass sich dieser Nachweis aus einer gerichtlichen Entscheidung ergibt, die gegen den Herausgeber der Website erwirkt wurde Zwei Geschäftsführer einer Gruppe von Investmentgesellschaften forderten Google auf, aus den Ergebnissen einer anhand ihrer Namen durchgeführten Suche die Links zu bestimmten Artikeln auszulisten, die das Anlagemodell dieser Gruppe kritisch darstellten. Sie machen geltend, dass diese Artikel unrichtige Behauptungen enthielten. Ferner forderten sie Google auf, dass Fotos von ihnen, die in Gestalt von Vorschaubildern („thumbnails") angezeigt werden, in der Übersicht der Ergebnisse einer anhand ihrer Namen durchgeführten Bildersuche gelöscht werden. In dieser Übersicht wurden nur die Vorschaubilder als solche angezeigt, ohne die Elemente des Kontexts der Veröffentlichung der Fotos auf der verlinkten Internetseite wiederzugeben. Anders ausgedrückt, wurde bei der Anzeige des Vorschaubildes der ursprüngliche Kontext der Veröffentlichung der Bilder nicht benannt und war auch im Übrigen nicht erkennbar. Google lehnte es ab, diesen Aufforderungen Folge zu leisten, und zwar unter Hinweis auf den beruflichen Kontext dieser Artikel und Fotos sowie unter Berufung darauf, nicht gewusst zu haben, ob die in diesen Artikeln enthaltenen Informationen unrichtig seien. Der mit diesem Rechtsstreit befasste deutsche Bundesgerichtshof hat den Gerichtshof darum ersucht, die Datenschutz-Grundverordnung, die u. a. das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden") regelt, und die Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr unter Berücksichtigung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auszulegen. In seinem heutigen Urteil erinnert der Gerichtshof daran, dass das Recht auf Schutz personenbezogener Daten kein uneingeschränktes Recht ist, sondern im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss. So sieht die Datenschutz-Grundverordnung ausdrücklich vor, dass das Recht auf Löschung ausgeschlossen ist, wenn die Verarbeitung u. a. für die Ausübung des Rechts auf freie Information erforderlich ist. Die Rechte der betroffenen Person auf Schutz der Privatsphäre und auf Schutz personenbezogener Daten überwiegen im Allgemeinen gegenüber dem berechtigten Interesse der Internetnutzer, die potenziell Interesse an einem Zugang zu der fraglichen Information haben. Der Ausgleich kann aber von den relevanten Umständen des Einzelfalls abhängen, insbesondere von der Art dieser Information, von deren Sensibilität für das Privatleben der betroffenen Person und vom Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu der Information, das u. a. je nach der Rolle, die die Person im öffentlichen Leben spielt, variieren kann. Allerdings kann das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information dann nicht berücksichtigt werden, wenn zumindest ein für den gesamten Inhalt nicht unbedeutender Teil der in dem aufgelisteten Inhalt stehenden Informationen unrichtig ist. Was zum einen die Verpflichtungen der Person, die wegen eines unrichtigen Inhalts die Auslistung begehrt, anbelangt, betont der Gerichtshof, dass dieser Person der Nachweis obliegt, dass die Informationen offensichtlich unrichtig sind oder zumindest ein für diese Informationen nicht unbedeutender Teil dieser Informationen offensichtlich unrichtig ist. Damit dieser Person jedoch keine übermäßige Belastung auferlegt wird, die die praktische Wirksamkeit des Rechts auf Auslistung beeinträchtigen könnte, hat sie lediglich die Beweise beizubringen, die von ihr vernünftigerweise verlangt werden können. Insoweit kann diese Person grundsätzlich nicht dazu verpflichtet werden, bereits im vorgerichtlichen Stadium eine – auch in Form einer im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergangene – gerichtliche Entscheidung vorzulegen, die gegen den Herausgeber der betreffenden Website erwirkt wurde. Was zum anderen die Verpflichtungen und den Verantwortungsbereich des Betreibers der Suchmaschine anbelangt, führt der Gerichtshof aus, dass sich dieser Betreiber infolge eines Auslistungsbegehrens auf alle betroffenen Rechte und Interessen sowie auf alle Umstände des Einzelfalls zu stützen hat, um zu prüfen, ob ein Inhalt in der Ergebnisübersicht der über seine Suchmaschine durchgeführten Suche verbleiben kann. Gleichwohl ist dieser Betreiber nicht verpflichtet, bei der Suche nach Tatsachen, die von dem Auslistungsantrag nicht gestützt werden, aktiv mitzuwirken, um festzustellen, ob dieser Antrag stichhaltig ist. Folglich ist der Betreiber der Suchmaschine dann, wenn die eine Auslistung begehrende Person relevante und hinreichende Nachweise vorlegt, die ihr Begehren stützen können und belegen, dass die in dem aufgelisteten Inhalt stehenden Informationen offensichtlich unrichtig sind, verpflichtet, diesem Auslistungsantrag nachzukommen. Dies gilt umso mehr, wenn diese Person eine gerichtliche Entscheidung vorlegt, die das feststellt. Dagegen ist bei Nichtvorliegen einer solchen gerichtlichen Entscheidung dieser Betreiber, wenn sich aus den von der betroffenen Person vorgelegten Nachweisen nicht offensichtlich ergibt, dass die in dem aufgelisteten Inhalt stehenden Informationen unrichtig sind, nicht verpflichtet, einem solchen Auslistungsantrag stattzugeben. Allerdings muss sich die Person, die in einem solchen Fall die Auslistung begehrt, an die Kontrollstelle oder das Gericht wenden können, damit diese die erforderlichen Überprüfungen vornehmen und den Verantwortlichen anweisen, die gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Ferner verlangt der Gerichtshof von dem Betreiber der Suchmaschine, dass er die Internetnutzer über ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren informiert, in dem die Frage geklärt werden soll, ob in einem Inhalt enthaltene Informationen unrichtig sind, sofern dem Betreiber dieses Verfahren zur Kenntnis gebracht worden ist. In Bezug auf die Anzeige der Fotos in Gestalt von Vorschaubildern („thumbnails") betont der Gerichtshof, dass die nach einer namensbezogenen Suche erfolgende Anzeige von Fotos der betroffenen Person in Gestalt von Vorschaubildern einen besonders starken Eingriff in die Rechte dieser Person auf Schutz des Privatlebens und der personenbezogenen Daten dieser Person darstellen kann. Der Gerichtshof stellt fest, dass der Betreiber einer Suchmaschine, wenn er in Bezug auf in Gestalt von Vorschaubildern angezeigte Fotos mit einem Auslistungsantrag befasst wird, prüfen muss, ob die Anzeige der fraglichen Fotos erforderlich ist, um das Recht auf freie Information auszuüben, das den Internetnutzern zusteht, die potenziell Interesse an einem Zugang zu diesen Fotos haben. Insoweit stellt der Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem Interesse einen entscheidenden Gesichtspunkt dar, der bei der Abwägung der widerstreitenden Grundrechte zu berücksichtigen ist. Der Gerichtshof stellt klar, dass eine unterschiedliche Abwägung der widerstreitenden Rechte und Interessen vorzunehmen ist: Einerseits dann, wenn es sich um Artikel handelt, die mit Fotos versehen sind, die in ihrem ursprünglichen Kontext die in diesen Artikeln enthaltenen Informationen und die dort zum Ausdruck gebrachten Meinungen veranschaulichen, und andererseits dann, wenn es sich um Fotos handelt, die in Gestalt von Vorschaubildern in der Ergebnisübersicht außerhalb des Kontexts angezeigt werden, in dem sie auf der ursprünglichen Internetseite veröffentlicht worden sind. Im Rahmen der Abwägung hinsichtlich der in Gestalt von Vorschaubildern angezeigten Fotos kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass ihrem Informationswert unabhängig vom Kontext ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite, der sie entnommen sind, Rechnung zu tragen ist. Allerdings ist jedes Textelement zu berücksichtigen, das mit der Anzeige dieser Fotos in den Suchergebnissen unmittelbar einhergeht und Aufschluss über den Informationswert dieser Fotos geben kann. HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden.
Mit Urteil vom 27.10.2022, Az. I ZR 141/21 hat der Bundesgerichtshof – anders als noch das Berufungsgericht – entschieden, dass die Verjährung einer der Höhe nach unbestimmten Vertragsstrafe (sog. "Hamburger Brauch") erst mit der höhenmäßigen Bestimmung der Vertragsstrafe durch den_die Gläubiger_in zu laufen beginnt; ab diesem Vertragsstrafeverlangen verjährt die Vertragsstrafe in drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem die Bestimmung erfolgt ist. Ein beziffertes Vertragsstrafeversprechen verjährt demgegenüber drei Jahre nach Ende des Jahres, in dem der Verstoß gegen die strafbewehrte Unterlassungserklärung schuldhaft begangen wurde und der_die Gläubiger_in davon Kenntnis erlangt hat. Einem_er Vertragsstrafeschuldner_in, der_die ein besonderes Interesse daran hat, möglichst bald zu erfahren, ob und in welcher Höhe er_sie eine Vertragsstrafe schuldet, steht es frei, bei Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung statt einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" eine feste Vertragsstrafe zu versprechen. Zudem kann er_sie ggf. nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB eine Klage auf Leistungsbestimmung durch das Gericht erheben: >> "III. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei unbegründet, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein durchsetzbarer Anspruch des Klägers auf Zahlung der geltend gemachten Vertragsstrafe nicht verneint werden. Damit kann auch die Abweisung des Antrags auf Erstattung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten keinen Bestand haben. 1. Für die rechtliche Prüfung in der Revisionsinstanz ist zugunsten des Klägers davon auszugehen, dass ihm gegen den Beklagten ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe in der geforderten Höhe zusteht. Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass der Beklagte schuldhaft gegen seine Unterlassungserklärung verstoßen und deshalb eine Vertragsstrafe verwirkt habe, indem er nicht dafür gesorgt habe, dass das Lichtbild aus seinen Verkaufsangeboten auf allen Länderseiten der Internet-Handelsplattform eBay entfernt worden sei. Es hat ferner unterstellt, dass der Kläger mit Einschreiben vom 22. Dezember 2016, dessen Annahme der Beklagte unberechtigt verweigert habe, die Höhe der Vertragsstrafe verbindlich bestimmt habe. Dabei ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass eine Vertragsstrafe in der Weise vereinbart werden kann, dass dem Gläubiger gemäß § 315 Abs. 1 BGB für den Fall einer künftigen Zuwiderhandlung des Schuldners gegen die vertragliche Unterlassungspflicht die Bestimmung der Strafhöhe nach seinem billigen Ermessen überlassen bleibt und diese Bestimmung im Einzelfall nach § 315 Abs. 3 BGB durch ein Gericht überprüft werden kann ("Hamburger Brauch", vgl. BGH, Urteil vom 17. September 2009 – I ZR 217/07, GRUR 2010, 355 [juris Rn. 30] = WRP 2010, 649 – Testfundstelle; Urteil vom 13. November 2013 – I ZR 77/12, GRUR 2014, 595 [juris Rn. 18] = WRP 2014, 587 – Vertragsstrafenklausel; Wimmers in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 6. Aufl., § 97 UrhG Rn. 220). In einem solchen Fall bestimmt bei einer Zuwiderhandlung des Schuldners der Gläubiger gemäß § 315 Abs. 2 BGB gegenüber dem Schuldner die angemessene Höhe der nach § 339 Satz 2 BGB verwirkten Vertragsstrafe formlos durch eine einseitige empfangsbedürftige Erklärung (BeckOGK.BGB/Netzer, Stand 1. September 2022, § 315 Rn. 65 f.; MünchKomm.BGB/Würdinger, 9. Aufl., § 315 Rn. 44). Verweigert der Schuldner unberechtigt die Annahme einer schriftlichen Vertragsstrafenbestimmung seitens des Gläubigers, muss er sich gemäß § 242 BGB so behandeln lassen, als sei ihm die Erklärung zugegangen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 1982 – V ZR 24/82, NJW 1983, 929 [juris Rn. 29]; Urteil vom 26. November 1997 – VIII ZR 22/97, BGHZ 137, 205 [juris Rn. 18]; Grüneberg/Ellenberger, BGB, 81. Aufl., § 130 Rn. 16). 2. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Beklagte könne die Zahlung der vom Kläger verlangten Vertragsstrafe gemäß § 214 Abs. 1 BGB verweigern, weil ein möglicher Vertragsstrafeanspruch verjährt sei. a) Ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstoßes gegen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die – wie hier – wegen der Beanstandung einer Urheberrechtsverletzung abgegeben worden ist, verjährt als ausschließlich vertraglich begründeter Anspruch nach den zivilrechtlichen Regelungen der §§ 194 ff. BGB (Dreier in Dreier/Schulze, UrhG, 7. Aufl., § 102 Rn. 4; J. B. Nordemann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Aufl., § 102 UrhG Rn. 5; Wimmers in Schricker/Loewenheim aaO § 102 UrhG Rn. 1; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 – I ZR 176/93, BGHZ 130, 288 [juris Rn. 26] – Kurze Verjährungsfrist). Gemäß § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (Nr. 1) und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (Nr. 2). b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die dreijährige Verjährungsfrist habe gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit Ablauf des Jahres 2014 begonnen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, für den Beginn der Verjährung sei nicht auf den Zeitpunkt der zu unterstellenden Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts durch den Kläger im Jahr 2016 abzustellen. Maßgeblich sei das Jahr 2014, in dem aufgrund der zu unterstellenden letzten Verletzungshandlung des Beklagten im Mai 2014 ein möglicher Vertragsstrafeanspruch entstanden sei (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB) und der Kläger Kenntnis von der Zuwiderhandlung erlangt habe (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Diese Annahme ist von Rechtsfehlern beeinflusst. bb) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Anspruch im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden, sobald er erstmals geltend gemacht und im Wege der Klage durchgesetzt werden kann (BGH, Urteil vom 8. Juli 2008 – XI ZR 230/07, NJW-RR 2009, 378 [juris Rn. 17]; Beschluss vom 22. März 2017 – XII ZB 56/16, NJW 2017, 1954 [juris Rn. 13]; Urteil vom 3. August 2017 – VII ZR 32/17, WM 2018, 1856 [juris Rn. 14]). Dafür genügt es nicht, dass der Schuldner die anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale verwirklicht hat und der Anspruch daher nach allgemeiner Terminologie entstanden ist (Großkomm.UWG/Toussaint, 3. Aufl., § 11 Rn. 46; BeckOGK.BGB/Piekenbrock, Stand 1. August 2022, § 199 Rn. 16). Vielmehr ist darüber hinaus grundsätzlich die Fälligkeit des Anspruchs erforderlich, die dem Gläubiger die Möglichkeit der Leistungsklage verschafft (vgl. BGH, Urteil vom 8. April 2015 – IV ZR 103/15, NJW 2015, 1818 [juris Rn. 22]; Urteil vom 17. Juli 2019 – VIII ZR 224/18, WM 2020, 425 [juris Rn. 16]). Erst ab diesem Zeitpunkt kann der Gläubiger gemäß § 271 BGB die Leistung verlangen und nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB die Verjährung durch Klageerhebung hemmen (vgl. BGH, NJW-RR 2009, 378 [juris Rn. 17]). Eine solche Auslegung des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB folgt aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Der Gesetzgeber wollte an der bisherigen Rechtslage festhalten, dass die Verjährung grundsätzlich mit der Fälligkeit des Anspruchs beginnt. Durch die Wahl des Begriffs "Entstehung" wollte er klarstellen, dass ein Schadensersatzanspruch weiterhin nach dem Grundsatz der Schadenseinheit auch hinsichtlich vorhersehbarer künftiger Schadensfolgen zu verjähren beginnt, sobald irgendein (Teil-)Schaden entstanden ist und gerichtlich geltend gemacht werden kann, obwohl der Anspruch bezüglich der drohenden Schäden nicht als fällig bezeichnet werden kann (vgl. Begründung des Abgeordneten- und Fraktionsentwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, BT-Drucks. 14/6040, S. 108; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, BT-Drucks. 14/7052, S. 180). cc) Nach diesen Grundsätzen ist der vom Kläger geltend gemachte Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" nicht vor dem Jahr 2016 im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden. (1) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass ein möglicher Verstoß des Beklagten gegen seine Unterlassungserklärung einen Vertragsstrafeanspruch vor dem Jahr 2016 begründet hat. (a) Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so tritt gemäß § 339 Satz 2 BGB die Verwirkung der Vertragsstrafe mit der Zuwiderhandlung ein. Mit dem schuldhaften Verstoß des Schuldners gegen seine strafbewehrte Unterlassungserklärung fällt die Vertragsstrafe automatisch an (vgl. BGH, Urteil vom 10. März 1986 – II ZR 147/85, NJW-RR 1986, 1159 [juris Rn. 10 f.]; BeckOGK.BGB/Ulrici, Stand 1. September 2021, § 339 Rn. 140; Grüneberg/Grüneberg aaO § 339 Rn. 17; Staudinger/Rieble, BGB [2020, Updatestand 9. Mai 2021], § 339 Rn. 604). Das gilt auch im Fall eines Vertragsstrafeversprechens nach "Hamburger Brauch", bei dem der Gläubiger die Höhe der angefallenen Vertragsstrafe gemäß § 315 Abs. 1 und 2 BGB noch konkretisieren muss (vgl. Horschitz, NJW 1973, 1958, 1960; BeckOGK.BGB/Ulrici aaO § 339 Rn. 140; vgl. auch Ahrens/Achilles, Der Wettbewerbsprozess, 9. Aufl., Kap. 9 Rn. 16; Großkomm.UWG/Feddersen aaO § 13a Rn. 30). (b) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass der Beklagte seiner Unterlassungserklärung schuldhaft zuwidergehandelt habe, indem er nicht veranlasst habe, dass das Lichtbild aus seinen Verkaufsangeboten auf allen Länderseiten der Internet-Handelsplattform eBay entfernt worden sei. Danach ist ein Vertragsstrafeanspruch des Klägers dem Grunde nach bereits im Juni 2013 nach allgemeiner Terminologie entstanden. Das Berufungsgericht ist erkennbar davon ausgegangen, dass ein von Juni 2013 bis Mai 2014 fortwährendes Versäumnis des Beklagten, für die Beseitigung des Lichtbilds zu sorgen, nach dem Unterlassungsvertrag als eine einheitliche dauerhafte Zuwiderhandlung anzusehen wäre. Diese Beurteilung wird von den Parteien nicht in Frage gestellt und lässt keinen Rechtsfehler erkennen (vgl. BGH, Urteil vom 4. Mai 2017 – I ZR 208/15, GRUR 2017, 823 [juris Rn. 36 bis 38] = WRP 2017, 944 – Luftentfeuchter, mwN). (2) Ein möglicher Vertragsstrafeanspruch des Klägers ist jedoch nicht vor seinem Vertragsstrafeverlangen im Dezember 2016 fällig geworden. (a) Ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" wird – anders als ein Anspruch auf Zahlung einer festen Vertragsstrafe (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 1971 – VII ZR 112/69, NJW 1971, 883 [juris Rn. 17]; Urteil vom 19. Mai 2022 – VII ZR 149/21, BauR 2022, 1342 [Rn. 33 f.]; BAGE 22, 205 [juris Rn. 17]; BeckOGK.BGB/Ulrici aaO § 339 Rn. 239) – nicht schon mit der Zuwiderhandlung fällig, sondern erst, wenn der Gläubiger nach § 315 Abs. 1 und 2 BGB sein Leistungsbestimmungsrecht gegenüber dem Schuldner verbindlich ausgeübt und die Höhe der verwirkten Vertragsstrafe wirksam konkretisiert hat (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 122/05, BGHZ 167, 139 [juris Rn. 21]; BeckOGK.BGB/Netzer aaO § 315 Rn. 79; Staudinger/Rieble aaO § 315 Rn. 489; zur Leistungsbestimmung durch Urteil vgl. BGH, Urteil vom 4. Juli 2013 – III ZR 52/12, NJW-RR 2014, 492 [juris Rn. 32]; BAGE 164, 82 [juris Rn. 110]). (b) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass der Kläger mit Einschreiben vom 22. Dezember 2016 die zu zahlende Vertragsstrafe verbindlich auf 3.600 € festgelegt habe. Dann aber ist der mögliche Vertragsstrafeanspruch erst im Dezember 2016 fällig geworden und damit im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB entstanden. Die Verjährung begann danach gemäß § 199 Abs. 1 BGB erst mit Ablauf des Jahres 2016 (vgl. BeckOGK.BGB/Netzer aaO § 315 Rn. 79; Staudinger/Rieble aaO § 315 Rn. 493 und § 339 Rn. 524; zur Leistungsbestimmung durch Urteil vgl. BGH, Urteil vom 24. November 1995 – V ZR 174/94, NJW 1996, 1054 [juris Rn. 29]; aA Piekenbrock, ZIP 2010, 1925, 1929 f.). dd) Es besteht kein Grund, bei dem in Rede stehenden Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" die Entstehung des Anspruchs im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB und damit den Verjährungsbeginn – abweichend von dem allgemeinen Grundsatz – nicht an die bei Festlegung der Vertragsstrafe eintretende Fälligkeit des Anspruchs, sondern an die Vollendung der Zuwiderhandlung zu knüpfen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist eine solche Vorverlagerung nicht mit Blick auf den Zweck der Verjährung geboten, den Schuldner vor Beweisschwierigkeiten zu schützen und nach einer bestimmten Zeitdauer Rechtsfrieden eintreten zu lassen (zum mit Rechnungserteilung fälligen Anspruch vgl. BGH, WM 2020, 425 [juris Rn. 30]; zum Zweck der Verjährung vgl. auch BGH, Urteil vom 29. Januar 2008 – XI ZR 160/07, BGHZ 175, 161 [juris Rn. 24]; BGH, WM 2018, 1856 [juris Rn. 22]). (1) Allerdings kann der Gläubiger in der Regel seit der Vollendung der Zuwiderhandlung jederzeit die Höhe der Vertragsstrafe anhand der maßgeblichen Kriterien bestimmen und so für die Fälligkeit des Vertragsstrafeanspruchs sorgen (vgl. Piekenbrock, ZIP 2010, 1925, 1929; Ahrens/Achilles aaO Kap. 9 Rn. 16). Auch bei anderen Ansprüchen mit hinausgeschobener, von der Disposition des Gläubigers abhängiger Fälligkeit beginnt die Verjährung indessen nicht schon mit dem Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger die Fälligkeit hätte herbeiführen können (zur Leistungsbestimmung durch den Gläubiger vgl. BGH, NJW 1996, 1054 [juris Rn. 30]; Staudinger/Rieble aaO § 339 Rn. 524; zum mit [Ab-]Rechnungserteilung fälligen Anspruch vgl. BGH, Rechtsentscheid vom 19. Dezember 1990 – VIII ARZ 5/90, BGHZ 113, 188 [juris Rn. 19]; BGH, WM 2020, 425 [juris Rn. 29]; Gegenäußerung der Bundesregierung betreffend die Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, BT-Drucks. 14/6857, S. 42 f.; zum Zahlungsanspruch "gegen Dokumente" vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 1971 – VIII ZR 4/70, BGHZ 55, 340 [juris Rn. 5 und 8]). (2) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts steht dem Verjährungsbeginn mit der durch Festlegung der Vertragsstrafe eintretenden Fälligkeit des Vertragsstrafeanspruchs nicht entgegen, dass der Gläubiger nach Belieben den Anfang der Verjährungsfrist hinausschieben und dadurch den Eintritt der Verjährung hinauszögern könnte. Die Revision weist zu Recht darauf hin, dass der Gläubiger regelmäßig ein Interesse daran hat, durch die Ausübung seines Leistungsbestimmungsrechts die Fälligkeit und damit die Durchsetzbarkeit seines Vertragsstrafeanspruchs bald herbeizuführen (vgl. BGHZ 113, 188 [juris Rn. 20]; BGH, WM 2020, 425 [juris Rn. 29]; Kaiser, Die Vertragsstrafe im Wettbewerbsrecht, 1999, S. 176). (3) Durch eine verzögerte Festlegung der Vertragsstrafe seitens des Gläubigers werden schutzwürdige Belange des Schuldners regelmäßig nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt. Hat der Gläubiger sein Leistungsbestimmungsrecht nicht innerhalb einer objektiv angemessenen Zeit ausgeübt und möchte der Schuldner Klarheit darüber gewinnen, ob und in welcher Höhe er eine Vertragsstrafe verwirkt hat, so kann er nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB eine Klage auf Leistungsbestimmung durch das Gericht erheben (vgl. BGH, Urteil vom 9. Mai 2012 – XII ZR 79/10, NJW 2012, 2187 [juris Rn. 37]) und durch die Erwirkung eines rechtskräftigen Gestaltungsurteils die Fälligkeit des Vertragsstrafeanspruchs und damit den Verjährungsbeginn selbst herbeiführen (vgl. BGH, NJW 1996, 1054 [juris Rn. 29 f.]). Dem Schuldner, der zeitliche Unwägbarkeiten bei der Durchsetzbarkeit einer Vertragsstrafe von vornherein vermeiden möchte, steht es im Übrigen frei, bei Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung statt einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" eine feste Vertragsstrafe zu versprechen. (4) Dem berechtigten Interesse des Schuldners, in nicht zu ferner Zeit zu erfahren, ob er vom Gläubiger auf Zahlung einer bestimmten Vertragsstrafe in Anspruch genommen wird (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1997 – I ZR 71/95, GRUR 1998, 471 [juris Rn. 32] = WRP 1998, 164 – Modenschau im Salvatorkeller), wird ferner dadurch Rechnung getragen, dass dem Gläubiger die verzögerte Geltendmachung einer Vertragsstrafe im Einzelfall nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) verwehrt sein kann. Aufgrund der aus dem Unterlassungsvertrag folgenden Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen Teils (§ 241 Abs. 2 BGB) und mit Blick auf die Funktion der Vertragsstrafe, weitere Zuwiderhandlungen des Schuldners zu verhindern (BGH, Urteil vom 30. September 1993 – I ZR 54/91, GRUR 1994, 146 [juris Rn. 20] = WRP 1994, 37 – Vertragsstrafebemessung; Urteil vom 17. Juli 2008 – I ZR 168/05, GRUR 2009, 181 [juris Rn. 42] = WRP 2009, 182 – Kinderwärmekissen), hat der Gläubiger dem Schuldner beizeiten zu verdeutlichen, dass er den Verstoß gegen die Unterlassungserklärung nicht hinnimmt (vgl. BGH, GRUR 1998, 471 [juris Rn. 33] – Modenschau im Salvatorkeller). Legt er über längere Zeit keine Vertragsstrafe fest, so kann er seinen Vertragsstrafeanspruch gemäß § 242 BGB verwirken, wenn der Schuldner darauf vertraut hat und nach dem gesamten Verhalten des Gläubigers darauf vertrauen durfte, dass dieser wegen des in Rede stehenden Verhaltens keine Vertragsstrafe (mehr) verlangen werde (vgl. BGH, GRUR 1998, 471 [juris Rn. 30 bis 33] – Modenschau im Salvatorkeller; OLG Frankfurt, GRUR 1996, 996 [juris Rn. 3]; zum mit [Ab-]Rechnungserteilung fälligen Anspruch vgl. BGH, Rechtsentscheid vom 11. April 1984 – VIII ARZ 16/83, BGHZ 91, 62 [juris Rn. 26 und 28]; BGHZ 113, 188 [juris Rn. 20]; BGH, Urteil vom 21. Juni 2001 – VII ZR 423/99, NJW-RR 2001, 1383 [juris Rn. 10]; Urteil vom 27. November 2003 – VII ZR 288/02, BGHZ 157, 118 [juris Rn. 35]; BT-Drucks. 14/6857, S. 42 f.). c) Entsteht demnach der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit der Festlegung der Vertragsstrafe durch den Gläubiger, so kommt es nicht darauf an, ob er – wie die Revision geltend macht – als verhaltener Anspruch zu behandeln ist, für den ein von § 199 Abs. 1 BGB abweichender Verjährungsbeginn bestimmt wäre. … d) Folglich begann die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB gemäß § 199 Abs. 1 BGB nicht vor dem Schluss des Jahres 2016, in dem der Kläger einen möglichen Anspruch auf Zahlung einer bestimmten Vertragsstrafe gegenüber dem Beklagten geltend gemacht hat. …"
Social Media-Konten dürfen vom Anbieter nur dann gesperrt werden, wenn dem betroffenen Nutzer unverzüglich der Grund für die Sperrung mitgeteilt wird; nicht erforderlich ist aber eine genaue Begrünung (rechtliche Subsumtion) dahingehend, weshalb es sich um einen zur Account-Sperrung führenden Verstoß handelt. Zudem sind die Löschung eines Beitrags und eine Account-Sperrung nur dann zulässig, wenn die AGB (Nutzungsbedingungen) des Anbieters eine Regelung enthalten, wonach ein Nutzer über die Entfernung eines Beitrags zumindest unverzüglich nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung seines Nutzerkontos vorab zu informieren ist, und ein verbindliches Verfahren zur Anhörung des betroffenen Nutzers besteht, OLG München, Urt v. 20.09.2022, Az. 18 U 6314/20 Pre (nicht rechtskräftig / Revision teilweise zugelassen), Rz. 14 ff.: >> "2. Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung zu, ihn auf www.f…com zu sperren, ohne ihm zugleich den Anlass der Sperrung mitzuteilen. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf eine Mitteilung "in speicherbarer Form" sowie "der Begründung, weshalb es sich um einen Verstoß handeln soll", besteht dagegen – anders als es das Landgericht angenommen hat – nicht. … (2) Die in das Vertragsverhältnis der Parteien einbezogenen Klauseln in Nr. 3.2 und Nr. 1 der Nutzungsbedingungen halten indessen einer Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff BGB nicht stand. Der darin enthaltene Sperrungsvorbehalt ist gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, weil ein verbindliches Verfahren zur Anhörung des betroffenen Nutzers fehlt (vgl. BGH a.a.O., Rn. 51 ff.). Die nach dem Bundesgerichtshof erforderliche Abwägung der einander gegenüberstehenden Grundrechte und Interessen der Parteien sowie der einzubeziehenden Drittinteressen ergibt, dass die Beklagte als Anbieterin eines sozialen Netzwerks zwar grundsätzlich berechtigt ist, den Nutzern ihres Netzwerks in Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Einhaltung objektiver, überprüfbarer Kommunikationsstandards vorzugeben, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. In diesem Rahmen darf sie sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen die Kommunikationsstandards Maßnahmen zu ergreifen, die eine Entfernung einzelner Beiträge und die Sperrung des Netzwerkzugangs einschließen (vgl. BGH a.a.O., Leitsatz 2 und Rn. 78). Für einen interessengerechten Ausgleich der kollidierenden Grundrechtspositionen und damit die Wahrung der Angemessenheit im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB ist jedoch erforderlich, dass sich die Beklagte in ihren Geschäftsbedingungen dazu verpflichtet, den betreffenden Nutzer über die Entfernung seines Beitrags zumindest unverzüglich nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung seines Nutzerkontos grundsätzlich vorab zu informieren, ihm den Grund dafür mitzuteilen und eine Möglichkeit zur Gegenäußerung einzuräumen, an die sich eine Neubescheidung anschließt (vgl. BGH a.a.O., Leitsatz 3 und Rn. 85, 87 f.). Diesen verfahrensrechtlichen Anforderungen genügen die Nutzungsbedingungen der Beklagten nicht, da es an der Normierung eines entsprechenden verbindlichen Verfahrens fehlt (vgl. BGH a.a.O., Rn. 93 ff.). bb) Im Übrigen folgt der Senat der Auffassung des Landgerichts, dass vorliegend auch deshalb von einer vertraglichen Pflichtverletzung der Beklagten durch die verhängte Sperre auszugehen ist, da die Beklagte der ihr insoweit obliegenden sekundären Darlegungslast bezüglich eines angeblichen Verstoßes des Klägers gegen die Nutzungsbedingungen bereits nicht nachgekommen ist bzw. durch die endgültige Löschung der Daten den Nachweis einer vertraglichen Pflichtverletzung ihrerseits durch den Kläger vereitelt hat. … Aus diesem Grund ist auch von einem Fortbestehen des Nutzungsvertrages zwischen den Parteien auszugehen; die von der Beklagten wohl intendierte außerordentliche Kündigung mit anschließender Deaktivierung und Löschung des Kontos ist unwirksam. Bei Verhängung der Sperre wurde zudem ausweislich der Screenshots auf S. 18 der Klage (Bl. 18 d.A.) ein Grund hierfür nicht angegeben. … e) In inhaltlicher Hinsicht kann der Kläger von der Beklagten verlangen, es zu unterlassen, ihn (erneut) zu sperren, ohne ihm unverzüglich den Anlass der Sperrung mitzuteilen. Ein darüber hinausgehender Anspruch besteht jedoch nicht. aa) Hinsichtlich des Umfangs der Mitteilungspflichten kann der Kläger allein die Mitteilung verlangen, welches Verhalten zum Anlass der Sperre genommen wurde, nicht jedoch eine weitergehende Begründung im Sinne einer rechtlichen Subsumtion, weshalb es sich um einen Verstoß handeln soll. Dies ergibt sich auch aus einem Vergleich mit dem NetzDG: So soll nach dessen Gesetzesbegründung „die in den Beschwerdesystemen der sozialen Netzwerke übliche Multiple-Choice-Begründungsform" im Rahmen der in § 3 Abs. 2 Nr. 5 NetzDG normierten Begründungspflicht ausreichen (BT-Drs. 18/12356, S. 23). Wenn die Sperre auf Gründe gestützt wird, die sich nicht auf rechtswidrige Inhalte nach dem NetzDG beziehen, kann insoweit kein strengerer Maßstab gelten. Gleiches gilt für die vom Kläger geforderte Mitteilung „in speicherbarer Form", die im NetzDG ebenfalls nicht vorgesehen ist. Es erscheint dem Kläger zumutbar, eine über die Plattform mitgeteilte Begründung ggf. durch einen Screenshot zu sichern. bb) Die Mitteilung des Anlasses der Sperrung hat … „unverzüglich" (anstatt wie beantragt „zugleich") zu erfolgen, d.h. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dem Bundesgerichtshof zufolge ist die erforderliche Anhörung des Nutzers – die neben der einleitenden Information über eine beabsichtigte Kontosperrung und der Mitteilung des Grundes hierfür auch die Möglichkeit des Nutzers zur Gegenäußerung mit einer anschließenden Neubescheidung umfasst – grundsätzlich vor der Sperrung des Kontos durchzuführen und nur in eng begrenzten, in Allgemeinen Geschäftsbedingungen näher zu bestimmenden Ausnahmefällen kann von einer vorherigen Durchführung abgesehen werden (vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2021 – III ZR 179/20, NJW 2021, 3179, Rn. 85 und 87). Die vom Kläger im Streitfall begehrte Mitteilung des Grundes bzw. Anlasses der Sperrung ist danach Teil des vom Bundesgerichtshofs geforderten Anhörungsverfahrens, das zwar regelmäßig, aber nicht ausnahmslos vor der Kontosperrung durchzuführen ist. … Die von der Beklagten angesprochene Möglichkeit einer außerordentlichen sofortigen Kündigung ihrerseits bei schweren, etwa strafrechtlich gravierenden Pflichtverletzungen des Nutzers ohne vorherige Abmahnung bleibt hiervon ohnehin unberührt. … 4. Der mit Berufungsantrag Ziff. 7 weiterverfolgte Anspruch des Klägers auf „Schadensersatz" in Höhe von 1.500 € besteht nicht. … a) Unabhängig von der fehlenden Zulässigkeit des Antrags sind auch – wie das Landgericht zutreffend erkannt hat – die tatbestandlichen Voraussetzungen der geltend gemachten Ansprüche nicht erfüllt. aa) Ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 i.V.m. §§ 249 ff. BGB scheitert jedenfalls daran, dass der Kläger nicht nachvollziehbar dargelegt hat, dass ihm ein materieller Schaden in Höhe des geltend gemachten Betrages entstanden ist. Die Darlegungs- und Beweislast für die Entstehung des Schadens und dessen Höhe trifft bei sämtlichen Haftungstatbeständen den Geschädigten (vgl. Grüneberg/Grüneberg a.a.O., §280 Rn. 34 und Grüneberg/Sprau a.a.O., §823 Rn. 80 f.). Allein der zeitweiligen Einschränkung der privaten Kommunikationsmöglichkeiten des Klägers auf „Facebook" und dem Verlust des Zugriffs auf seine Daten kommt für sich genommen kein Vermögenswert zu. Die Einschränkung des „Kontakts nach außen" kann allenfalls im Rahmen des von §823 Abs. 1 BGB als „sonstiges Recht" geschützten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (vgl. hierzu Grüneberg/Sprau a.a.O., § 823 Rn. 137 ff.) einen Vermögensschaden begründen. Wegen eines immateriellen Schadens kann gemäß §253 Abs. 1 BGB Entschädigung in Geld nur in den gesetzlich bestimmten Fällen gefordert werden. bb) Die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Schmerzensgeldanspruchs aus §253 Abs. 2 BGB liegen offensichtlich nicht vor. Der Kläger ist nicht in einem der in dieser Vorschrift genannten Rechtsgüter verletzt worden. Auf andere Rechtsgüter und absolute Rechte ist die Vorschrift nicht entsprechend anwendbar (vgl. Grüneberg/Grüneberg a.a.O., § 253 Rn. 11). cc) Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Geldentschädigung zu, weil er – wie oben unter Ziff. III 4 b) dargelegt – nicht in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG) verletzt worden ist. Darüber hinaus würde es in Übereinstimmung mit dem Landgericht auch an den weiteren Voraussetzungen für die Zubilligung einer Geldentschädigung fehlen, wonach es sich um eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung handeln muss und die Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend aufgefangen werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2013 – VI ZR 211/12, NJW 2014, 2029, juris Rn. 38). So beschränkte sich die angegriffene Funktionseinschränkung sich auf einen Zeitraum von 30 Tagen; auch war die Nutzungsmöglichkeit während dieses Zeitraums nicht vollständig aufgehoben, sondern das Konto in den „Nur-Lese-Modus" versetzt. Die dem Kläger infolge der Vertragspflichtverletzung grundsätzlich zustehenden Ansprüche auf Unterlassung, Folgenbeseitigung und Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution sind außerdem als hinreichender Ausgleich für die erlittene Beeinträchtigung anzusehen. b) Ein Anspruch des Klägers gegen die Beklagte auf Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr kommt nicht in Betracht. … c) Schließlich scheidet auch ein Anspruch des Klägers auf Ersatz des immateriellen Schadens nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO aus. Nach dieser Vorschrift hat jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verantwortlichen. Die Verarbeitung der Daten der Klägerin durch die Beklagte verstieß aber nicht gegen die DS-GVO; denn sie beruhte auf der vorab erteilten Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen der Beklagten im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO und auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Im Übrigen gilt auch für diese Anspruchsgrundlage, dass ersatzfähig alle Nachteile sind, die der Geschädigte an seinem Vermögen oder an sonst rechtlich geschützten Gütern erleidet (vgl. Kühling/Buchner/Bergt, DS-GVO, 3. Aufl. 2020, Art. 82 Rn. 19). Ein solch immaterieller Schaden, der hier allenfalls an eine – ggf. auch weniger schwerwiegende – Verletzung des Persönlichkeitsrechts anknüpfen könnte (vgl. hierzu Becker in: Plath, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2018, Art. 82 DSGVO Rn. 4c; Wybitul, Immaterieller Schadensersatz wegen Datenschutzverstößen, NJW 2019, 3265, 3267), liegt jedoch wie dargelegt nicht vor. Die bloße Sperrung des klägerischen Nutzerkontos begründet einen solchen Schaden nicht. …" Vgl. auch: BGH, Urteil vom 29.07.2021, Az. III ZR 179/20: Der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist grundsätzlich berechtigt, den Nutzern seines Netzwerks in AGB die Einhaltung objektiver, überprüfbarer Kommunikationsstandards vorzugeben, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Er darf sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen die Kommunikationsstandards Maßnahmen zu ergreifen, die eine Entfernung einzelner Beiträge und die Sperrung des Netzwerkzugangs einschließen. Der Anbieter des sozialen Netzwerks hat sich jedoch in seinen Geschäftsbedingungen zu verpflichten, den Nutzer über die Entfernung seines Beitrags zumindest unverzüglich nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung seines Nutzerkontos vorab zu informieren, ihm den Grund dafür mitzuteilen und eine Möglichkeit zur Gegendarstellung einzuräumen, an die sich eine Neubescheidung anschließt, mit der die Möglichkeit der Wiederzugänglichmachung des entfernten Beitrags einhergeht. BGH, Urteil vom 29.07.2021, Az. III ZR 192/20: zur Rechtmäßigkeit einer vorübergehenden Teilsperrung eines Facebook-Benutzerkontos und der Löschung eines Beitrags durch Facebook. KG Berlin, Urteil vom 14.3.2022, Az. 10 U 1075/20.
Mit zwei Urteilen von 02.11.2022 (Az. AN 14 K 22.00468, Az. AN 14 K 21.01431) hat das Verwaltungsgericht Ansbach entschieden, dass das Fotografieren von Falschparkern, und das Senden dieser Fotos per Email an die zuständigen Verkehrsbehörden, keinen Verstoß gegen die Vorgaben der DSGVO darstellt. Fraglich war insb. ob bei der digitalen Übermittlung der Falschparker-Fotos um eine rechtmäßige Datenverarbeitung i.S.d DSGVO handelt, wonach dafür ein berechtigtes Interesse bestehen und die Datenübermittlung und -verarbeitung erforderlich sein muss; beides hat das Gericht bejaht.
Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) befasst sich auf Ihre diesjährigen Jahreskonferenz vom 10. bis 12. November 2022 im Paulinum der Universität Leipzig mit den rechtlichen und ethischen Fragen Künstlicher Intelligenz, dem europäischen Markt für Daten und aktuellen Fragen des Datenschutzes; einige Highlights: >> "KI aus maschinenethischer (technikphilosophischer) Sicht", Prof.in Dr.in Cathrin Misselhorn, Universität Göttingen "KI-Haftung", Prof. Dr. Gerhard Wagner, LL.M., Humboldt-Universität zu Berlin "KI-Regulierung (AI Act)", Prof.in Dr.in Janine Wendt, Technische Universität Darmstadt "Entwicklung des Datenmarkts aus ökonomischer Sicht", Dr. Klaus-Heiner Röhl, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) "Digital Services Act – Plattformregulierung nach dem DSA", Prof. Dr. Franz Hofmann, LL.M., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Das vollständige Programm finden Sie hier! Wir werden an der Tagung teilnehmen und stehen gerne auch dort für Gespräche zu Verfügung!
Was dem regelmäßigen Berliner Bus- und U-Bahn-Fahrer schier unglaublich erscheinen mag, hat des Landgericht Hamburg mit Urteil vom 09.11.2021, Az. 310 O 44/19 in der Sache des Designers Herbert Lindinger gegen die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG offiziell bestätigt: mit dem Würmchenmuster- bzw. "Urban Jungle"-Design der Sitzbezüge der verschiedene Verkehrsmittel der BVG handelt es sich um Kunstwerke i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Das Landgericht stellt dazu ausdrücklich fest, dass "Hässlichkeit" als bloße Geschmacksfrage kein Argument für oder gegen die Urheberrechtsfähigkeit einer Gestaltung sei: >> "Die vom Kläger geltend gemachten Klagemuster sind als Werke der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt. … a) Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen. Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt. Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maß die Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt (BGH GRUR 2014, 175 (179) Rn. 41 – Geburtstagszug). Urheberrechtsschutz für einen Gebrauchsgegenstand kommt daher nur in Betracht, wenn seine Gestaltung nicht nur eine technische Lösung verkörpert, sondern einen durch eine künstlerische Leistung geschaffenen ästhetischen Gehalt aufweist. Maßgebend ist allein, ob der ästhetische Gehalt als solcher ausreicht, um von einer künstlerischen Leistung zu sprechen (BGH GRUR 2012, 58 (60) Rn. 22 – Seilzirkus). Nach der Rechtsprechung des EuGH liegt erst bzw. bereits dann ein Werk vor, wenn der geschaffene Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt. Sofern die Schaffung eines Gegenstands durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt wurde, die der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand die für die Einstufung als Werk erforderliche Originalität aufweist (EuGH, Urt. v. 12.09.2019 – C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1186 f.) Rn. 30 f. – Cofemel/G-Star; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.06.2020 – C-833/18, GRUR 2020, 736 (737) Rn. 22 ff. – Brompton/Get2Get). b) Nach den vorstehenden Grundsätzen handelt es sich bei dem sog. Puzzlemuster um eine persönliche geistige Schöpfung gemäß §8 2 Abs. 2 UrhG. Der Gestaltungsspielraum des Klägers ist zwar eingeschränkt gewesen, weil das streitgegenständliche Muster auch einem Gebrauchszweck (Graffiti-Schutz) dient. Es ist aber ein ausreichender Gestaltungsspielraum für den Kläger verblieben, den dieser zur Überzeugung des Gerichts gemäß §$ 286 Abs. 1 ZPO bewusst nach seinen eigenen freien kreativen Entscheidungen ausgenutzt hat, um eine künstlerische Leistung zu erbringen, die seine Persönlichkeit widerspiegelt. Die Gestaltung weist über die technische Lösung hinaus einen ausreichenden ästhetischen Gehalt auf, um von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. (1) Der Gestaltungsspielraum des Klägers war zwar eingeschränkt, weil er von seiner Auftraggeberin, der W.- U., bzw. der Beklagten, die mit der W.- U. vertraglich verbunden gewesen ist, den Auftrag hatte, ein Sitzmuster mit Graffiti-Schutz zu schaffen. Diesem Gebrauchszweck diente unstreitig die Schaffung des streitgegenständlichen Musters in seinen in den Klagemustern zum Ausdruck kommenden Formen und Farben (vgl. auch Anlage B 10, S. 1 f.). Es spielt insoweit keine Rolle, ob man -– wie der Kläger im Rahmen seiner persönlichen Anhörung – von einem "zu berücksichtigenden Gesichtspunkt" oder – wie die Beklagte – von einer "Vorgabe" spricht. Der Kläger hat aber insoweit auch dargelegt, dass es dafür, einen Graffiti-Schutz auf Sitzbezügen durch eine bestimmte Mustergestaltung zu realisieren, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt … Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich derartige konkretisierte Vorgaben nicht bereits aus Natur und dem Inhalt des technischen Auftragsziels ergaben, eine Gestaltung mit Graffiti-Schutz zu erreichen. Soweit die Beklagte insofern geltend macht, die Farben und die Dicke des Musters ergäben sich aus der Art des Auftrags, dringt sie damit nicht durch. … (2) Die bestehenden verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von sog. Anti-Graffiti-Sitzmustern belegen auch, dass der Kläger seinen eigenen freien kreativen Entscheidungen ausgenutzt hat, um eine künstlerische Leistung zu erbringen, die seine Persönlichkeit widerspiegelt. Den Klagemustern ist – ungeachtet ihrer auch technischen Funktion – eine (möglicherweise künstlerisch umstrittene) ästhetische Wirkung und damit eine künstlerische Leistung nicht abzusprechen. … Die Kammer, deren Mitglieder zu den für Kunst empfänglichen und interessierten Kreisen gehören, kann diese Beschreibung nachvollziehen. Dass es für den Kläger nicht allein um eine x-beliebige, allein technisch motivierte Gestaltung ging, sondern um die ästhetische Eingliederung der Sitzbezüge in die Gesamtgestaltung des Fahrzeugs gehen sollte, liegt auf der Hand. Die Beschreibungen der Konzeption und Wirkung des Musters erscheinen als nachvollziehbar und sind Ausdruck einer künstlerischen Konzeption, die – ungeachtet ihres funktionalen Aspekts – jedenfalls auch und in erheblichem Maße auf eine ästhetische Wirkung zielen sollte. Soweit die Beklagte dem entgegenhält, der Erschaffer des streitgegenständlichen Musters habe sich lediglich den von sog. Tarnmustern bekannten Effekt zu Eigen gemacht um ein "Anti-Graffiti-Muster" zu schaffen, so folgt die Kammer dem nicht. … Soweit die Beklagte argumentieren lässt, die "Wuseligkeit" und Unruhe der Klagemuster sprächen das Auge gerade nicht an und hätten auch keinen künstlerischen Aussagegehalt, so dass das Muster in den Medien und der Öffentlichkeit sehr häufig als besonders hässlich bezeichnet und von Farbexperten kritisiert werde …, so steht dies – in tatsächlicher Hinsicht einmal als zutreffend unterstellt – der Annahme eines Urheberrechtsschutzes nicht entgegen; zu Recht hat der Kläger darauf hinweisen lassen, dass Hässlichkeit eine bloße Geschmacksfrage und daher kein Argument für oder gegen die Urheberrechtsfähigkeit ist. … Im Übrigen spricht insbesondere auch die Rezeption des Musters für einen Werkschutz. Das Muster ist zeitlos und hält sich seit den 1990er Jahren als Sitzmuster im öffentlichen Nahverkehr. Die Stilkritik im Hinblick auf die "neuen" Verwendungsformen durch die Beklagte, u.a. für Merchandise-Artikel, reicht von "frech, selbstbewusst, B. like" bis hin zu "grausig". Bei künstlerischen Leistungen mit ästhetischem Gehalt ist es nicht selten, dass sie kontroverse Beurteilungen provozieren. So ist das Muster schon bei der Präsentation der S-Bahnwagen im Jahr 1989 kommentiert worden. Der urheberrechtliche Schutz ist jedoch nicht abhängig von einer (wie auch immer zu bestimmenden) "künstlerischen Qualität" der Arbeit. Der offenbar bestehende Streit über die Ästhetik der Klagemuster spricht aber indiziell für ihre ästhetische Wirkung und für eine künstlerische Leistung (welchen künstlerischen Wert auch immer man ihr zuerkennen mag), weil die Diskussionen um die Sitzbezugsmuster zeigen, dass diese von den Betrachtern eben nicht nur als funktional bedingt, sondern als mit ästhetischer Wirkung versehen und damit als künstlerisch gestaltet wahrgenommen werden. (2) Die Kammer ist davon überzeugt, dass dem Kläger seine vorstehend beschriebene künstlerische Gestaltung nicht konkret vorgegeben worden ist, sondern dass der Kläger einen ihm eröffneten Gestaltungsspielraum genutzt hat. …" Indem die BVG dieses Sitzmuster weit über den damals vertraglich eingeräumten Nutzungszweck hinaus nutze, u.a. für Busse und U-Bahnen, eine Kollektion von Gebrauchsgegenständen und vielfältige Merchandising-Produkte, hat sie nach Ansicht des Landgerichts in die urheberrechtlichen Verwertungsrechte des klagenden Designers aus § 16 UrhG (Rechts zur Vervielfältigung) und § 17 UrhG (Verbreitung) rechtswidrig eingegriffen. Grundsätzlich schuldet Sie ihm daher nach § 97 Abs. 1 UrhG Beseitigung und Unterlassen dieser Rechtsverletzungen, sowie Schadensersatz (§ 92 Abs. 2 UrhG). Allerdings hat das Landgericht Hamburg die BVG mit Rücksicht auf die Berliner Bus- und Bahnfahrer nicht dazu verdonnert, alle bereits verbauten Sitze / Sitzbezüge aus ihren Zügen und Bussen zu entfernen und zum Zwecke der Vernichtung an den Kläger herauszugeben; dies wäre nach Ansicht des Landgericht unverhältnismäßig i.S.v. § 98 Abs. 4 UrhG: "Ob die Vernichtung unverhältnismäßig ist, lässt sich nur im Einzelfall und nur nach einer umfassenden Abwägung des Vernichtungsinteresses des Verletzten einerseits und des Erhaltungsinteresses des Verletzers andererseits entscheiden … Nach § 98 Abs. 4 S. 4 UrhG sind auch berechtigte Interessen Dritter zu berücksichtigen. Zur Herausgabe der mit den Sitzbezügen versehenen Sitze aus den U-Bahnen und Bussen müssten diese entfernt werden. Ohne eine Einschränkung des Tenors (z.B. eine zeitliche Staffelung) würde dies zur Folge haben, dass jedenfalls bei Rechtskraft des Herausgabetenors (und ggf. schon im Rahmen der vorläufigen Vollstreckbarkeit bei Sicherheitsleistung) der öffentliche Nahverkehr in der Stadt Berlin ganz erheblich beeinträchtigt werden würde. Denn auf einen Schlag müssten in allen betroffenen Fahrzeugen die Sitze entfernt werden. Bis die Sitze durch andere Sitze mit einem anderen Muster ersetzt würden, wären die jeweiligen Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzbar. Insofern überwiegen gegenüber dem klägerischen Rechtsschutzinteressen eindeutig die Erhaltungsinteressen der Beklagten und der Berliner Öffentlichkeit.
Eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer "künstlerischen" Leistung gesprochen werden kann (BGH, Urt. v. 13..11.2013 – I ZR 143/12, GRUR 2014, 175 (176) Rn. 15 – Geburtstagszug; Urt. v. 12.05.2011 – I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 (60) Rn. 17 – Seilzirkus).
Wie angedeutet, könnten im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung mildere Maßnahmen (z.B. eine großzügige zeitliche Staffelung) zu erwägen sein. Ob und welche weniger einschneidenden Maßnahmen (Minus-Maßnahmen) vorliegend als verhältnismäßig anzusehen wären, kann und muss aber offenbleiben, weil eine solche Minus-Maßnahme nicht streitgegenständlich ist. § 98 Abs. 1 UrhG sieht derartige Minus-Maßnahmen nicht vor. Sie finden daher ihre Rechtsgrundlage im allgemeinen Beseitigungsanspruch gemäß § 97 Abs. 1 UrhG, müssten dann aber auch als konkrete Maßnahme jedenfalls hilfsweise beantragt werden …"
Im Urteil vom 28.04.2022, Az. 5 U 48/05 – Metall auf Metall III hatte sich, nach dem Landgericht Berlin, auch das OLG Hamburg mit der Frage der Reichweite der neuen Pastiche-Schranke des § 51a UrhG zu befassen. Hintergrund ist der seit vielen Jahren u.a. vor dem Bundesgerichtshof BGH, dem Europäischem Gerichtshof EuGH und dem Bundesverfassungsgericht geführte Rechtsstreit zwischen der Musikgruppe Kraftwerk, die den Titel "Metall auf Metall" geschaffen hat, und dem Musikproduzenten Moses Pelham, der eine kurze Tonfolge aus diesem Titel entnommen und in den von ihm produzierten Sabrina Setlur-Hit "Nur mir" eingebaut hat, in dem es um die Frage der rechtlichen Zulässigkeit dieses Samplings geht. Das OLG Hamburg hat diese Frage nun bejaht und – unter Zulassung der erneuten Revision zum BGH – entschieden, dass Sampling im Regelfall als Pastiche gem. § 51a UrhG zulässig ist, und zwar auch im Hinblick auf die Leistungsschutzrechte des Tonträgerherstellers: >> "Auch bei Schluss der mündlichen Verhandlung im Berufungsrechtszug ist eine Rechtsverletzung zu verneinen, so dass die Voraussetzungen eines in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs nicht gegeben sind. Die Beklagten können sich nunmehr auf die Gestattung durch § 51a UrhG n.F. berufen. Durch Gesetz vom 31.05.2021 (BGBl. I S. 1204) ist mit Wirkung zum 07.06.2021 § 24 UrhG aufgehoben und das Recht der frei- en Bearbeitung in § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG n.F. fortgeführt worden. Zudem ist neu eingeführt worden die Vorschrift des § 51a UrhG n.F. (Karikatur, Parodie und Pastiche), … Der in der deutschen Rechtswirklichkeit nicht gebräuchliche Begriff des Pastiches ist von seinem Inhalt noch weitgehend unklar …. Im Ausgangspunkt geht es im Kern um einen kommunikativen Akt der stilistischen Nachahmung, wobei auch die Übernahme fremder Werke oder Werkteile erlaubt ist, der ei- ne bewertende Referenz auf ein Original voraussetzt (LG Berlin, Urteil vom 02.11.2021 – 15 O 551/19, GRUR-RS 2021, 48603 Rn. 35). In der Literatur und in der Gesetzesbegründung finden sich Vorschläge zu potenziellen Fallgruppen, wie u.a. Fan-Fiction, Remix, Memes, Sampling (vgl. Hofmann, GRUR 2021, 895, 898). Der Gesetzgeber hat nach der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs „Sampling" ausdrücklich als einen möglichen Fall des Pastiches angesehen (BT-Drucks 19/27426 S. 91) … Soweit dies in der Literatur teilweise so verstanden wird, dass damit der Gesetzgeber in einer denkbar weiten Auslegung des Begriffs davon ausgehe, dass die Pastiche-Schranke die kreative Nutzung vorbestehender Schutzgegenstände für neues Schaffen gestatte (BeckOK UrhR/Lauber-Rönsberg, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 51a Rn. 17), ist eine solche Interpretation keineswegs zwingend. Überzeugend erscheint indes die Annahme, dass die Schranke in Art. 5 Abs. 3 Buchst. k InfoSoc-RL nicht auf reine Stilimitationen zu beschränken ist, da diese ohnehin keine Verletzung des Urheberrechts beinhalten würden. Zwar hat der Generalanwalt beim EuGH (Szpunar) den Begriff des Pastiches als eine Nachahmung des Stils eines Werks oder eines Urhebers bezeichnet, ohne dass not- wendigerweise Bestandteile dieses Werks übernommen werden (vgl. Schlussantrag vom 12.12.2018 – C-476/17, BeckRS 2018, 33735 Fussnote 30). Da indes der Stil eines Au- tors, Künstlers oder Musikers als solcher ohnehin nicht urheberrechtlich geschützt ist, wäre eine darauf bezogene Schrankenregelung obsolet (vgl. Dreier/Schulze, 7. Aufl., UrhG § 51a Rn. 18). Der Senat ist daher mit dem Bundesgesetzgeber und weiteren Stimmen in der Literatur der Auffassung, dass der Richtliniengeber mit der Pastiche-Regelung eine Grundlage für die erkennbare Übernahme der schöpferischen Züge konkret in Bezug genommener Werke habe schaffen wollen (vgl. auch Stieper, GRUR 2020, 699). bb) Zugleich ist durch eine Interessenabwägung sowie die Anwendung des Drei-Stufen-Tests zu gewährleisten, dass die nach § 51a UrhG n.F. gestatteten transformativen Nutzungen die berechtigten Interessen der Rechtsinhaber nicht beeinträchtigen. … Daher setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Gerichtshofs der Europäischen Union das Eingreifen der Schranke von Parodien, Karikaturen und Pastiches wegen der insoweit maßgeblichen unionsrechtskonformen Auslegung nicht (mehr) voraus, dass durch die Benutzung des fremden Werkes eine persönliche geistige Schöpfung iSv § 2 Abs. 2 UrhG entsteht (vgl. BGH, Urteil vom 28.07.2016 – I ZR 9/15 GRUR 2016, 1157 Rn. 28 – auf fett getrimmt). In Abgrenzung zum unzulässigen Plagiat muss das ältere Werk allerdings so benutzt werden, dass es in einer veränderten Form erscheint. Dazu reicht es aus, dem Werk andere Elemente hinzuzufügen oder das Werk in eine neue Gestaltung zu integrieren, vgl. § 62 Abs. 4a UrhG (LG Berlin, Urteil vom 02.11.2021 – 15 O 551/19, GRUR-RS 2021, 48603 Rn. 35). … Nach Maßgabe dieser Grundsätze stellt im Streitfall die Übernahme eines kleinen, aber doch prägenden Klangfetzens, dessen beständige Wiederholung und Einbettung in ein eigenständiges Werk ein Pastiche iSd § 51a UrhG n.F. dar. aa) Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Generalanwalt in der Sache "Metall auf Metall" eine Interaktion mit dem benutzten Werk oder zumindest mit dessen Urheber in einem Fall des Sampling wie dem im Ausgangsrechtsstreit als nicht gegeben angesehen hat (vgl. GenA [Szpunar], BeckRS 2018, 33735 Rn. 70). Der EuGH hat jedoch, wie ausgeführt, zum parallelen Begriff der „Parodie" aus Art. 5 Abs. 3 Buchst. k RL 2001/29 angenommen, dass dieser Begriff nicht von weiteren Voraussetzungen abhängt, dass etwa die Parodie einen eigenen ursprünglichen Charakter hat, der nicht nur darin besteht, gegenüber dem par- odierten ursprünglichen Werk wahrnehmbare Unterschiede aufzuweisen, oder dass sie vernünftigerweise einer anderen Person als dem Urheber des ursprünglichen Werkes zu- geschrieben werden kann, oder dass sie das ursprüngliche Werk selbst betrifft oder dass sie das parodierte Werk angibt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 972 Rn. 33 – Deckmyn/Vrijheids-fonds; Senat, Urteil vom 10.06.2021 – 5 U 80/20, GRUR-RR 2022, 116 Rn. 60 – Ottifanten in the city). Daher ist nach Auffassung des Senats die erforderliche künstlerische Interaktion nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagten die Entnahme einer Sequenz aus dem Werk der Kläger weder auf den Tonträgern noch an anderer Stelle publik gemacht oder sogar in Abrede genommen haben. Vielmehr ist die Angemessenheit dieser Übernahme im Rahmen des Drei-Stufen-Tests zu beurteilen, wobei auch der vorgenannte Gesichtspunkt im Rahmen dieser Interessenabwägung berücksichtigt werden kann. Soweit der Generalanwalt im vorliegenden Fall gerade eine umgekehrte Situation aus- gemacht hat, nämlich die Übernahme eines Tonträgers, die dazu dient, ein Werk in ei- nem völlig anderen Stil zu schaffen, steht auch dies nach Auffassung des Senats der Annahme eines Pastiches nicht entgegen. Denn für einen Kulturschaffenden führt nicht selten die Nachahmung oder Hommage in eine neue Form künstlerischen Ausdrucks. Im Streitfall haben die Beklagten die in Rede stehende Sequenz als Einleitung für ein sich langsam aufbauendes Stück verwendet, dass nach Hinzutreten immer weiterer Ton- und Rhythmuslinien nach und nach in einen Hip Hop-Song wechselt. Ebenso wie der Gesetz-geber zitierende, imitierende und anlehnende Kulturtechniken als ein prägendes Element der Intertextualität und des zeitgemäßen kulturellen Schaffens in der digitalen Welt anerkennt, ist eine künstlerische Auseinandersetzung in umgekehrter Richtung an- zuerkennen (LG Berlin, GRUR-RS 2021, 48603 Rn. 38). Auch der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Technik des "Elektronischen Kopierens von Audiofragmenten" (Sampling) so beschrieben, dass ein Nutzer – zumeist mithilfe elektronischer Geräte – einem Tonträger ein Audiofragment entnimmt und dieses zur Schaffung eines neuen Werkes nutzt. Dieses Verhalten hat er als eine künstlerische Ausdrucksform anerkannt, die unter die durch Art. 13 EU-GrCh geschützte Freiheit der Kunst fällt (vgl. EuGH, GRUR 2019, 929 Rn. 35 – Pelham/Hütter [M. a. M. III]). Insoweit hat der EuGH in seinem Urteil im Fall "Metall auf Metall" das von der Kunstfreiheit gem. Art. 13 GRCh geschützte eigene künstlerische Schaffen durchaus mit der Schaffung eines "neuen Werkes" in Verbindung gebracht (Stieper, GRUR 2020, 699, 703; aA Hofmann, GRUR 2021, 895, 898), und damit auch die Schaffung eines Werks in einem völlig anderen Stil. Die Zulässigkeit des Pastiche scheitert auch nicht an der Schranken-Schranke des Art. 5 Abs. 5 der RL 2001/29/EG, … Dreistufentest … Nach Art. 5 Abs. 5 der RL 2001/29/EG dürfen die in den Abs. 1, 2, 3 und 4 der Vorschrift genannten Ausnahmen und Beschränkungen nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. Mit "bestimmt" ist gemeint, dass der Anwendungsbereich durch begrenzende Umschreibungen eingeengt wird. Er kann dabei quantitativ oder qualitativ begrenzt sein; eine starre Schwelle existiert nicht (Senat, GRUR-RR 2022, 116 Rn. 71 und 73 – Ottifanten in the city, mwN). Im vorliegenden Fall liegt ein solcher bestimmter Sonderfall iSd Art. 5 Abs. 5 der RL 2001/29/EG vor. Es geht um den benannten Fall des Pastiches durch die Übernahme einer Tonsequenz aus einem geschützten Werk und deren Einbettung in ein (eigenständiges) neues Werk. Die normale Verwertung des Werkes "Metall auf Metall" der Kläger wird hier auch nicht in relevanter Weise beeinträchtigt. Nach der Entscheidung des BVerfG hat die hier konkret in Rede stehende Entnahme dem Urheber des Originals nicht die Möglichkeit genommen, einen zufriedenstellenden Ertrag aus seinen Investitionen zu erzielen, weil das neu geschaffene Werk einen großen Abstand hält und keine Konkurrenzsituation mit dem ursprünglichen Tonträger begründet (GRUR 2016, 690 Rn. 102-107): Eine Gefahr von Absatzrückgängen für die Kl. des Ausgangsverfahrens im Hinblick auf ihr Album "Trans Europa Express" oder auch nur den Titel "Metall auf Metall" durch die Übernahme der Sequenz in die beiden streitgegenständlichen Versionen des Titels "Nur mir" ist nicht ersichtlich … Allein der Umstand, dass für den konkreten Fall des Sampling dessen Zulässigkeit entsprechend § 24 I UrhG dem Tonträgerhersteller die Möglichkeit einer Lizenzeinnahme nimmt, bewirkt ebenfalls nicht ohne Weiteres – und insbesondere nicht im vorliegenden Fall – einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil des Tonträgerherstellers. Schließlich kann ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil auch nicht damit begründet werden, dass der Verwender des Sample durch die Übernahme das eigene Nachspielen und damit eigene Aufwendungen vermeide (vgl. in diesem Sinne das angegriffene Urteil des OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 3 [4]). Hierin liegt zunächst lediglich ein wirtschaftlicher Vorteil des Sampleverwenders durch die erzielte Ersparnis. Dieser korrespondiert aber nicht automatisch mit einem entsprechenden Nachteil des Herstellers des Originaltonträgers. … (3) Danach steht hier ein geringfügiger Eingriff in das Tonträgerherstellerrecht ohne erhebliche wirtschaftliche Nachteile einer erheblichen Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigungs- und Entfaltungsfreiheit gegenüber. Diesen Ausführungen schließt sich der erkennende Senat an und macht sie sich zu Eigen. Eine Konkurrenz der Tonträger der Beklagten mit denen der Kläger ist in Bezug auf die beiden sich gegenüberstehenden Musikwerke zu verneinen. Sie gehören unterschiedlichen Stilrichtungen an. Und selbst bei einem sich überschneidenden Interesse von Musikliebhabern an beiden Stücken vermag der Erwerb des einen Tonträgers den Erwerb des anderen nicht zu ersetzen und umgekehrt. Die Kläger berufen sich auch ohne Erfolg darauf, die Entnahme durch die Beklagten habe ihre Vermarktungschancen von Samplinglizenzen geschmälert. Die Kläger haben diesen Vortrag, den die Beklagten bestritten haben, nicht weiter substantiiert. Ein solches ist auch nicht ersichtlich, da die Entnahme zwanzig Jahre nach Erscheinen des Klagemusters erfolgte und damit zu einem Zeitpunkt, als die zentralen Verwertungshandlungen der Kläger ungeachtet ihrer fort- dauernden Popularität im Wesentlichen bereits in der Vergangenheit lagen. Auch ansonsten werden die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers hier nicht ungebührlich verletzt. Die dritte Teststufe enthält eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, in der die widerstreitenden Interessen der Rechtsinhaber mit den Interessen abgewogen werden müssen, die durch die Schranke privilegiert sind. Wie ausgeführt, steht der Pastiche als Kunstform in gleicher Weise unter dem Schutz der Kunstfreiheit nach Art. 13 GRCh und Art. 5 Abs. 3 GG wie das Original. Jedem Künstler steht davon abgeleitet auch das Recht der Vermarktung seiner Kunst zu und damit auch das Recht, weitere Verwertungshandlungen vorzunehmen. Insoweit begründet der Umstand, die Beklagten könnten letztlich nur am kommerziellen Erfolg interessiert seien, keine Rechtswidrigkeit ihres Handelns (vgl. Senat, GRUR-RR 2022, 116 Rn. 83 – Ottifanten in the city). … Aus denselben Gründen ist eine Verletzung der Leistungsschutzrechte als ausübende Künstler (§ 73 UrhG) und des Urheberrechts des Klägers zu 1. zu verneinen."
Wie schon Karikatur und Parodie, muss aber auch der Pastiche eine Auseinandersetzung mit dem vorbestehenden Werk oder einem sonstigen Bezugsgegenstand erkennen lassen (Dreier/Schulze, 7. Aufl., UrhG § 51a Rn. 18). Vor dem Hintergrund, dass einerseits das Bearbeitungsrecht gemäß § 23 UrhG n.F. zu den durch das Unionsrecht harmonisierten Verwertungsrechten gehört und andererseits jede Übernahme eines veränderten, aber noch erkennbaren Schutzgegenstands einen Eingriff in die Verwertungsrechte darstellt, kommt der Schrankenregelung des § 51a UrhG n.F. die Funktion zu, kreatives Schaffen auf Grundlage des Vorbestehenden als Ausfluss der Kunst- und Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 GG bzw. Art. 11 und 13 EU-GrCh zu ermöglichen und somit einen Ausgleich zwischen Kreativen herzustellen (vgl. BeckOK UrhR/Lauber-Rönsberg, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 51a Rn. 17). Einen Ausfluss der Kunst- und Meinungsfreiheit stellt eine erkennbare Übernahme von Bestandteilen fremder Werke daher nur dann dar, wenn ebenso wie bei der Ausnahme des Zitats eine Interaktion mit dem benutzten Werk oder zumindest mit dessen Urheber stattfindet (vgl. GenA [Szpunar], BeckRS 2018, 33735 Rn. 70). Denn die Ausnahmen für Zitate oder Karikaturen, Parodien oder Pastiches, ermöglichen den Dialog und die künstlerische Auseinandersetzung durch Bezugnahmen auf bereits bestehende Werke (GenA [Szpunar], BeckRS 2018, 33735 Rn. 95).
Das Stück "Nur mir" enthält mit der entlehnten Tonfolge eine stilistische Nachahmung im Sinne einer Hommage an das Werk "Metall auf Metall" der Kläger. Der Beklagte zu 2. hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorgebracht, dass er sich mit der Kälte des Klangs von "Metall auf Metall" bzw. der dieses Stück prägende Rhythmussequenz in dem Stück "Nur mir" habe auseinandersetzen wollen. Dass sich der Beklagte zu 2. erklärtermaßen nicht mit den Klägern selbst hatte auseinandersetzen wollen, sondern eben nur mit dem Klang des von ihnen geschaffenen Werks, steht der Schutzfähigkeit dieser Ausdrucksform als Ausübung der Kunst- und Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 GG bzw. Art. 11 und Art. 13 EU-GrCh nicht entgegen. Auch steht der Schutzfähigkeit dieser Ausdrucksform nicht entgegen, dass, wie die Kläger geltend machen, die Motivation des Beklagten zu 2. schon deshalb keine Hommage gewesen sein könne, weil er die Übernahme anfänglich stets bestritten habe. Für die Eröffnung des Schutzbereichs der Kunstfreiheit ist nicht Voraussetzung, dass sich der Nutzer auf die Ausübung der Kunstfreiheit ausdrücklich beruft und die Wege des Schaffensprozesses darlegt bzw. einräumt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Anwendbarkeit urheberrechtlicher Schutzschranken unerheblich, welche Zielrichtung der Urheber des neuen Werkes mit seiner Umgestaltung im Einzelnen verfolgt hat. Es bedarf daher keiner Feststellungen einer auf eine Nachahmung oder Hommage gerichteten Intention des Bearbeiters. Vielmehr ist im Wesentlichen objektiv danach zu beurteilen, ob im Einzelfall eine Nutzung einer Schutzschranke vorliegt, ob diese Art der künstlerischen Auseinandersetzung für denjenigen erkennbar ist, dem das ursprüngliche Werk bekannt ist und der das für die Wahrnehmung einer Karikatur, Parodie oder Pastiche erforderliche intellektuelle Verständnis besitzt (vgl. BGH, GRUR 2016, 1157 Rn. 33 – auf fett getrimmt, zur Parodie).
105 Der Grund dafür, dem Tonträgerhersteller ein besonderes gesetzliches Schutzrecht zu gewähren, war nicht, ihm Einnahmen aus Lizenzen für die Übernahme von Aus- schnitten in andere Tonaufnahmen zu sichern, sondern der Schutz vor einer Gefährdung seines wirtschaftlichen Einsatzes durch Tonträgerpiraterie (vgl. Entwurf ei- nes Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte v. 23.3.1962, BT-Drs. IV/270, 34; BVerfGE 81, 12 [18] = GRUR 1990, 183 – Vermietungsvorbehalt). Der Schutz kleiner und kleinster Teile durch ein Leistungsschutzrecht, das im Zeitablauf die Nutzung des kulturellen Bestandes weiter erschweren oder unmöglich machen könnte, ist jedenfalls von Verfassungs wegen nicht geboten (vgl. von Ungern-Stern- berg, GRUR 2010, 386 [387]).
Vom 30. September 30 bs zum 2. October 2022 werde ich an der Jahreskonferenz der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung DAJV an der Northwestern Pritzker Law School in Chicago teilnehmen und mich mit den jüngsten Entwicklungen im amerikanischen Recht und den transatlantischen Beziehungen vertraut machen. / I will be at the Annual Conference on German and American Law 2022 at Northwestern Pritzker Law School in Chicago from September 30 to October 2, 2022. >> This year, Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung (DAJV) will hold its Annual Conference on German and American Law at Northwestern Pritzker Law School in Chicago from September 30 to October 2, 2022. The program includes a speech of the Chief Justice of the German Constitutional Court ("Bundesverfassungsgericht") Prof. Dr. Stephan Harbarth. In addition, the conference agenda will feature current topics in corporate/capital market law, arbitration law, data protection law and patent protection with high-ranking experts. Moreover, considering current times of economic and political crisis, the conference will take a look at the state of the transatlantic relationship and reflect on how peace order might look in the aftermath of the war in Ukraine.
Mit Urteil vom 09.08.2022, Az. VI ZR 1244/20, hat der BGH erneut zu den Prüfpflichten von Bewertungsportalen entschieden. Neu: Hat ein bewerteter Dienstleister (dort: ein Hotel) den Verdacht, dass (schlechte) Bewertungen ohne vorherige Nutzung seiner Leistung abgegeben wurden, reicht es aus, wenn er die Inanspruchnahme seiner Leistungen durch die bewertenden Personen bestreitet. Das Bewertungsportal muss dann eine Überprüfung einleiten; tut es dies nicht, muss es die Bewertungen löschen: ... mehr cc) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin Beanstandungen erhoben hat, die so konkret gefasst sind, dass Rechtsverstöße auf der Grundlage ihrer Behauptungen unschwer zu bejahen sind und bei der Beklagten Prüfpflichten ausgelöst haben. Diesen Prüfpflichten ist die Beklagte nicht nachgekommen, weshalb davon auszugehen ist, dass den angegriffenen Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt. (1) Entgegen der Ansicht der Revision reicht eine Rüge des Bewerteten, der Bewertung liege kein Gästekontakt zugrunde, grundsätzlich aus, um Prüfpflichten des Bewertungsportals auszulösen. Zu weiteren Darlegungen, insbesondere einer näheren Begründung seiner Behauptung des fehlenden Gästekontakts, ist er gegenüber dem Bewertungsportal grundsätzlich nicht verpflichtet. Dies gilt nicht nur in dem Fall, dass die Bewertung keinerlei tatsächliche, die konkrete Inanspruchnahme der Leistung beschreibende Angaben enthält und dem Bewerteten daher eine weitere Begründung schon gar nicht möglich ist, sondern auch dann, wenn für einen Gästekontakt sprechende Angaben vorliegen (Klarstellung zu Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 26). Denn der Bewertete kann diese Angaben regelmäßig nicht überprüfen und damit den behaupteten Gästekontakt nicht sicher feststellen. Einer näheren Begründung der Behauptung des fehlenden Gästekontakts bedarf es nur, wenn sich die Identität des Bewertenden für den Bewerteten ohne Weiteres aus der Bewertung ergibt. Im Übrigen gilt die Grenze des Rechtsmissbrauchs. Auf der Grundlage der Behauptung, den angegriffenen Bewertungen liege kein Gästekontakt zugrunde, ist ein Rechtsverstoß unschwer, das heißt ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung, zu bejahen (vgl. Senatsurteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 26). (2) Nach diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die Rügen der Klägerin, den Bewertungen der Nutzer mit den Namen "Sandra", "Nadine", "M und S", "Sven", "Mari", "Karri", "Franzi", "Anja" und "Jana" liege kein Gästekontakt zugrunde, hinreichend konkret waren. Zu weitergehenden Angaben als der, dass diese Nutzer nicht ihre Gäste waren, war die Klägerin – entgegen der Ansicht der Revision – auch angesichts der in den angegriffenen Bewertungen enthaltenen weiteren Angaben zu der Person des Nutzers, seinen Begleitern, den (angeblich) in Anspruch genommenen Leistungen und teilweise beigefügter Fotos nicht verpflichtet. Auf die zwischen den Parteien streitige und vom Berufungsgericht verneinte Frage, ob die Klägerin aufgrund der in den angegriffenen Bewertungen enthaltenen Ausführungen zu weiteren Angaben überhaupt in der Lage war, um den Kreis der in Betracht kommenden Gäste einzugrenzen, kommt es nicht an. Auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts ist auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Rügen missbräuchlich erhoben hätte. Die Rügen der Klägerin haben eine Prüfpflicht der Beklagten ausgelöst, der diese nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht nachgekommen ist. Die Beklagte hat jede Nachfrage bei ihren Nutzern verweigert. Es ist daher davon auszugehen, dass den angegriffenen Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt. g) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler die für einen Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB erforderliche Wiederholungsgefahr bejaht. Ist bereits eine rechtswidrige Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen erfolgt, besteht eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen der Wiederholungsgefahr (vgl. Senatsurteile vom 4. Dezember 2018 – VI ZR 128/18, NJW 2019, 1142 Rn. 9; vom 29. Juni 2021 – VI ZR 52/18, NJW 2021, 3130 Rn. 25; jeweils mwN). Dies gilt auch für das Unternehmenspersönlichkeitsrecht." Betreiber von Bewertungsportalen haften dabei zwar i.d.R.nicht als Täter für eine rechtswidrige Bewertung Dritter, aber als sog. Störer; die Privilegierungen des Telemediengesetzes gelten insoweit nicht: b) Die Beklagte ist nicht bereits nach § 10 TMG von der Verantwortlichkeit für den Inhalt der von ihr betriebenen Webseite befreit. Sie ist zwar Diensteanbieterin nach § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG, da sie Telemedien im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 TMG zur Nutzung bereithält. Sie betreibt eine Webseite und speichert dort unter anderem Bewertungen von Nutzern, die sich mit einer E-Mail-Adresse bei der Beklagten registriert haben, zum Zweck des Abrufs. Die Beklagte ist damit Hostprovider. Die Haftungsbeschränkung des § 10 Satz 1 TMG gilt aber nicht für Unterlassungsansprüche, die ihre Grundlage – wie hier – in einer vorangegangenen Rechtsverletzung haben (st. Rspr., vgl. nur Senatsurteile vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 19; vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 19 mwN). Dies steht nicht im Widerspruch zu den Regelungen der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ECRL; ABl. 2000 Nr. L 178, S. 1). Art. 14 Abs. 3 ECRL lässt die Möglichkeit zu, dass ein Gericht nach dem Rechtssystem der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern (vgl. auch Erwägungsgrund 48 ECRL; Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 20). c) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass es im Streitfall nicht um die Haftung der Beklagten als unmittelbare Störerin (in der Diktion des I. Zivilsenats "Täterin"; zu den unterschiedlichen Begrifflichkeiten des Senats einerseits und des I. Zivilsenats andererseits vgl. Senatsurteile vom 4. April 2017 – VI ZR 123/16, NJW 2017, 2029 Rn. 18; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 16; jeweils mwN) geht. Unmittelbare Störerin könnte die Beklagte nur dann sein, wenn es sich bei den von der Klägerin angegriffenen Bewertungen um einen eigenen Inhalt der Beklagten handelte, wobei zu den eigenen Inhalten eines Portalbetreibers auch solche Inhalte gehören, die zwar von einem Dritten eingestellt wurden, die sich der Portalbetreiber aber zu eigen gemacht hat. Von einem Zu-Eigen-Machen ist dann auszugehen, wenn der Portalbetreiber nach außen erkennbar die inhaltliche Verantwortung für die auf seiner Internetseite veröffentlichten Inhalte übernommen hat, was aus Sicht eines verständigen Durchschnittsnutzers auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände zu beurteilen ist. Dabei ist bei der Annahme einer Identifikation mit fremden Inhalten grundsätzlich Zurückhaltung geboten (vgl. Senatsurteile vom 27. Februar 2018 – VI ZR 489/16, BGHZ 217, 350 Rn. 28; vom 1. März 2016-VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 17 mwN). Nach diesen Maßstäben hat sich die Beklagte die von der Klägerin beanstandeten Bewertungen nicht zu eigen gemacht. Dass die Beklagte – was für ein Zu-Eigen-Machen spräche (vgl. Senatsurteile vom 14. Januar 2020 – VI ZR 495/18, VersR 2020, 485 Rn. 39; vom 4. April 2017 – VI ZR 123/16, NJW 2017, 2029 Rn. 18; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 18; jeweils mwN) – eine inhaltlich-redaktionelle Überprüfung der auf ihrem Portal eingestellten Nutzerbewertungen auf Vollständigkeit oder Richtigkeit vornimmt, ist vom Berufungsgericht nicht festgesteilt worden. Zur unmittelbaren Störerin wird die Beklagte – entgegen der Ansicht der Klägerin – auch nicht deshalb, weil sie eine Prämie für bis zu zehn Bewertungen pro Monat ausgelobt hat. Zwar muss der Betreiber eines Bewertungsportals Bewertungen Dritter (seiner Nutzer) i.d.R. nicht vorab, vor der Veröffentlichung, prüfen. Als Hostprovider i.s.d. TMG ist er aber verantwortlich, sobald er Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt; dann muss er einen behaupteten Verstoß überprüfen und dazu eine Stellungnahme des bewertenden Nutzers einholen: d) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte als mittelbare Störerin für die von der Klägerin beanstandeten Bewertungen nur eine eingeschränkte Verantwortlichkeit trifft. aa) Grundsätzlich ist als mittelbarer Störer verpflichtet, wer, ohne unmittelbarer Störer zu sein, in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Beeinträchtigung des Rechtsguts beiträgt. Dabei kann als Beitrag auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der in Anspruch Genommene die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Die Haftung als mittelbarer Störer darf aber nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden, welche die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben. Sie setzt deshalb die Verletzung von Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfpflichten, voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als mittelbarer Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen des Einzelfalls eine Verhinderung der Verletzung zuzumuten ist (vgl. Senatsurteile vom 27. Februar 2018 – VI ZR 489/16, BGHZ 217, 350 Rn. 31; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 22; vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 22; jeweils mwN). Danach ist ein Hostprovider zur Vermeidung einer Haftung als mittelbarer Störer grundsätzlich nicht verpflichtet, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Der Hostprovider ist aber verantwortlich, sobald er Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt. Weist ein Betroffener den Hostprovider auf eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechts – hier des Unternehmenspersönlichkeitsrechts -durch den Nutzer seines Angebots hin, kann der Hostprovider verpflichtet sein, künftig derartige Störungen zu verhindern (vgl. Senatsurteile vom 27. Februar 2018 – VI ZR 489/16, BGHZ 217, 350 Rn. 32; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 23; vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 24; jeweils mwN). bb) Ist der Provider mit der Beanstandung eines Betroffenen – die richtig oder falsch sein kann – konfrontiert, die so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer – das heißt ohne eingehende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung (vgl. Senatsurteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191,219 Rn. 25 f.) – bejaht werden kann, ist eine Ermittlung und Bewertung des gesamten Sachverhalts unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme des für den beanstandeten Beitrag Verantwortlichen erforderlich (vgl. Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 24 mwN). Dies gilt auch dann, wenn die beanstandete Äußerung nicht als Tatsachenbehauptung, sondern als Werturteil zu qualifizieren ist, das Werturteil vom Betroffenen aber mit der schlüssigen Behauptung als rechtswidrig beanstandet wird, der tatsächliche Bestandteil der Äußerung, auf dem die Wertung aufbaue, sei unrichtig, dem Werturteil fehle damit jegliche Tatsachengrundlage (vgl. Senatsurteile vom 27. Februar 2018 – VI ZR 489/16, BGHZ 217, 350 Rn. 32; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 24). cc) Zu welchen konkreten Überprüfungsmaßnahmen der Hostprovider verpflichtet ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Maßgebliche Bedeutung kommt dabei dem Gewicht der angezeigten Rechtsverletzung sowie den Erkenntnismöglichkeiten des Providers zu. Zu berücksichtigen sind aber auch Funktion und Aufgabenstellung des vom Provider betriebenen Dienstes sowie die Eigenverantwortung des für die persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigende Aussage unmittelbar verantwortlichen – ggf. zulässigerweise anonym oder unter einem Pseudonym auftretenden – Nutzers (vgl. Senatsurteile vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 38; vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 22; jeweils mwN). Zu berücksichtigen ist dabei, dass Bewertungsportale eine von der Rechtsordnung gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Funktion erfüllen (vgl. Senatsurteile vom 14. Januar 2020 – VI ZR 495/18, VersR 2020, 485 Rn. 46; vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 40; BGH, Urteil vom 20. Februar 2020 – I ZR 193/18, NJW 2020, 1520 Rn. 37 – Kundenbewertungen auf Amazon; Erwägungsgrund 47 der Richtlinie (EU) 2019/2161). Der vom Hostprovider zu erbringende Prüfungsaufwand darf den Betrieb seines Portals weder wirtschaftlich gefährden noch unverhältnismäßig erschweren. Ein solches Gewicht haben rein reaktive Prüfungspflichten, um die es im Streitfall allein geht, in der Regel aber nicht (vgl. Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 40). Auf der anderen Seite kann bei der Bestimmung des zumutbaren Prüfungsaufwands nicht außer Betracht bleiben, dass der Betrieb eines Portals mit Bewertungsmöglichkeit im Vergleich zu anderen Portalen, insbesondere Nachrichtenportalen, schon von vornherein ein gesteigertes Risiko für Persönlichkeitsrechtsverletzungen mit sich bringt. Es birgt die Gefahr, dass es auch für nicht unerhebliche persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerungen missbraucht wird. Der Portalbetreiber muss deshalb von Anfang an mit entsprechenden Beanstandungen rechnen. Dabei werden die mit dem Portalbetrieb verbundenen Missbrauchsgefahren noch dadurch verstärkt, dass die Bewertungen – rechtlich zulässig (vgl. § 19 Abs. 2 TTDSG) – anonym oder unter einem Pseudonym abgegeben werden können (vgl. Senatsurteile vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 40; vom 23. September 2014 – VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 34). Die Möglichkeit, Bewertungen verdeckt abgeben zu können, erschwert es dem Betroffenen zudem erheblich, unmittelbar gegen den betreffenden Portalnutzer vorzugehen. Der Hostprovider hat im Fall eines konkreten Hinweises auf einen auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer zu bejahenden Rechtsverstoß diese Beanstandung an den für den Inhalt Verantwortlichen zur Stellungnahme weiterzuleiten. Bleibt eine Stellungnahme innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist aus, ist von der Berechtigung der Beanstandung auszugehen und der beanstandete Eintrag zu löschen (vgl. Senatsurteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191,219 Rn. 27). Im konkreten Fall war das Bewertungsportal für Reisen seinen Prüfpflichten nicht nachgekommen. Es war daher davon auszugehen, dass den Bewertungen keine Nutzung der bewerteten Leistungen vorausging, sie also in das Blaue hinein, ohne ausreichende tatsächliche Grundlage, abgegeben wurden (möglicherweise auch, um dem bewerteten Hotel gezielt zu schaden): e) Die beanstandeten Bewertungen greifen in den Schutzbereich des Unternehmenspersönlichkeitsrechts der Klägerin ein. Betroffen ist der durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete soziale Geltungsanspruch der Klägerin als Wirtschaftsunternehmen (vgl. hierzu Senatsurteil vom 28. Juli 2015 – VI ZR 340/14, BGHZ 206, 289 Rn. 27 mwN). In den angegriffenen Bewertungen werden die Leistungen der Klägerin mit maximal drei Sonnensymbolen bewertet, wobei sechs Sonnensymbole die "Bestnote" sind. Im Freitext bemängeln die Nutzer unter anderem die Sauberkeit der Zimmer, den Zustand der Freizeitanlage und den Service der Klägerin. Die Kundgabe der angegriffenen Bewertungen auf der Webseite der Beklagten ist geeignet, sich abträglich auf das unternehmerische Ansehen der Klägerin auszuwirken. Die Bewertungen können dazu führen, dass potentielle Kunden die Leistungen der Klägerin nicht nachfragen. f) Es ist davon auszugehen, dass den noch in Streit stehenden Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt, weshalb die Beeinträchtigung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts der Klägerin rechtswidrig ist. aa) Wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss erst durch eine Abwägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange bestimmt werden, bei der die besonderen Umstände des Einzelfalles sowie die betroffenen Grundrechte und Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention interpretationsleitend zu berücksichtigen sind. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betroffenen die schutzwürdigen Belange der anderen Seite überwiegt (st. Rspr., vgl. nur Senatsurteile vom 14. Dezember 2021 – VI ZR 403/19, NJW-RR 2022, 419 Rn. 18; vom 16. November 2021 – VI ZR 1241/20, VersR 2022, 386 Rn. 15; vom 17. Dezember 2019 – VI ZR 249/18, VersR 2020, 567 Rn. 18; jeweils mwN). bb) Im Streitfall ist das Schutzinteresse der Klägerin mit der in Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 EMRK verankerten Meinungsäußerungsfreiheit der bewertenden Nutzer, der Informationsfreiheit der passiven Nutzer und der durch Art. 10 EMRK gewährleisteten Kommunikationsfreiheit der Beklagten sowie dem Schutz der geschäftlichen Tätigkeit der Beklagten nach Art. 8 Abs. 1 EMRK (vgl. BVerfGE 158, 1 Rn. 76) abzuwägen. Trifft die Behauptung der Klägerin zu, dass den angegriffenen Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt, ergibt diese Abwägung, dass die geschützten Interessen der Klägerin diejenigen der Beklagten und der Portalnutzer überwiegen. Bei Äußerungen, in denen sich – wie im vorliegenden Fall – wertende und tatsächliche Elemente in der Weise vermengen, dass die Äußerung insgesamt als Werturteil anzusehen ist, fällt bei der Abwägung zwischen den widerstreitenden Interessen der Wahrheitsgehalt der tatsächlichen Bestandteile ins Gewicht (vgl. Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 36 mwN). Ein berechtigtes Interesse der Nutzer, eine tatsächlich nicht stattgefundene Inanspruchnahme der Leistungen der Klägerin zu bewerten, ist nicht ersichtlich. Entsprechendes gilt für das Interesse der Beklagten, eine Bewertung über eine nicht stattgefundene Inanspruchnahme der Leistung der Klägerin zu kommunizieren, und für das Interesse der passiven Nutzer, eine solche Bewertung lesen zu können. cc) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin Beanstandungen erhoben hat, die so konkret gefasst sind, dass Rechtsverstöße auf der Grundlage ihrer Behauptungen unschwer zu bejahen sind und bei der Beklagten Prüfpflichten ausgelöst haben. Diesen Prüfpflichten ist die Beklagte nicht nachgekommen, weshalb davon auszugehen ist, dass den angegriffenen Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt. (1) Entgegen der Ansicht der Revision reicht eine Rüge des Bewerteten, der Bewertung liege kein Gästekontakt zugrunde, grundsätzlich aus, um Prüfpflichten des Bewertungsportals auszulösen. Zu weiteren Darlegungen, insbesondere einer näheren Begründung seiner Behauptung des fehlenden Gästekontakts, ist er gegenüber dem Bewertungsportal grundsätzlich nicht verpflichtet. Dies gilt nicht nur in dem Fall, dass die Bewertung keinerlei tatsächliche, die konkrete Inanspruchnahme der Leistung beschreibende Angaben enthält und dem Bewerteten daher eine weitere Begründung schon gar nicht möglich ist, sondern auch dann, wenn für einen Gästekontakt sprechende Angaben vorliegen (Klarstellung zu Senatsurteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 26). Denn der Bewertete kann diese Angaben regelmäßig nicht überprüfen und damit den behaupteten Gästekontakt nicht sicher feststellen. Einer näheren Begründung der Behauptung des fehlenden Gästekontakts bedarf es nur, wenn sich die Identität des Bewertenden für den Bewerteten ohne Weiteres aus der Bewertung ergibt. Im Übrigen gilt die Grenze des Rechtsmissbrauchs. Auf der Grundlage der Behauptung, den angegriffenen Bewertungen liege kein Gästekontakt zugrunde, ist ein Rechtsverstoß unschwer, das heißt ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung, zu bejahen (vgl. Senatsurteil vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219 Rn. 26). (2) Nach diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die Rügen der Klägerin, den Bewertungen der Nutzer mit den Namen "Sandra", "Nadine", "M und S", "Sven", "Mari", "Karri", "Franzi", "Anja" und "Jana" liege kein Gästekontakt zugrunde, hinreichend konkret waren. Zu weitergehenden Angaben als der, dass diese Nutzer nicht ihre Gäste waren, war die Klägerin – entgegen der Ansicht der Revision – auch angesichts der in den angegriffenen Bewertungen enthaltenen weiteren Angaben zu der Person des Nutzers, seinen Begleitern, den (angeblich) in Anspruch genommenen Leistungen und teilweise beigefügter Fotos nicht verpflichtet. Auf die zwischen den Parteien streitige und vom Berufungsgericht verneinte Frage, ob die Klägerin aufgrund der in den angegriffenen Bewertungen enthaltenen Ausführungen zu weiteren Angaben überhaupt in der Lage war, um den Kreis der in Betracht kommenden Gäste einzugrenzen, kommt es nicht an. Auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts ist auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Rügen missbräuchlich erhoben hätte. Die Rügen der Klägerin haben eine Prüfpflicht der Beklagten ausgelöst, der diese nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht nachgekommen ist. Die Beklagte hat jede Nachfrage bei ihren Nutzern verweigert. Es ist daher davon auszugehen, dass den angegriffenen Bewertungen kein Gästekontakt zugrunde liegt. g) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler die für einen Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB erforderliche Wiederholungsgefahr bejaht. Ist bereits eine rechtswidrige Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen erfolgt, besteht eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen der Wiederholungsgefahr (vgl. Senatsurteile vom 4. Dezember 2018 – VI ZR 128/18, NJW 2019, 1142 Rn. 9; vom 29. Juni 2021 – VI ZR 52/18, NJW 2021, 3130 Rn. 25; jeweils mwN). Dies gilt auch für das Unternehmenspersönlichkeitsrecht.
Webinar am 6. Juli 2022, 11:00 Uhr "Uploadfilter: Blockierung von Werbevideos und Fotos vermeiden – Das neue UrheberrechtsDiensteanbieterGesetz UrhDaG"
Werbekampagnen in Social Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Pinterest und Facebook gehören nicht nur bei der Einführung neuer Produkte dazu. Dabei kommen i.d.R. Videos und Produktfotografien zum Einsatz, die urheberrechtlich geschützt sind und urheberrechtlich geschützte Elemente wie z.B. Musiken oder die "Fabel" eines bekannten Franchise (z.B. Star Wars) enthalten. Jüngste Reformen des Urheberrechts und die Einführung des völlig neuen "Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes" (UrhDaG) haben hier umfassende Änderungen gebracht, die einerseits bestimmte Nutzungen im weiteren Umfang erlauben, als bisher. Andererseits sind Plattformen wie YouTube, Instagram, Pinterest und Facebook künftig verpflichten, sehr genau darauf zu achten, dass User nur "legale" Inhalte nutzen und auf ihren Plattformen veröffentlichen; rechtswidrige Inhalte müssen sie durch entsprechende Filter blocken, i.d.R. noch bevor diese Inhalte überhaupt veröffentlicht werden. ... mehr Schon aufgrund der schieren Menge an "User Generated Content" (UCG) müssen die Plattformen dazu automatisierte Filterverfahren einrichten, die – so ist zu befürchten – oftmals auch legale (lizenzierte) Inhalte fälschlich als rechtswidrig blocken; dies kann gravierende Folgen für den Nutzer habe, bis hin zur Sperrung seiner Plattform-Accounts! Wie soll ein Algorithmus auch erkennen, ob es sich mit einer werblichen Anspielung auf die Star Wars-Saga (z.B.https://www.youtube.com/watch?v=_Ut1Ak7zOeE) um ein zulässiges Pastiche oder ein zulässige Parodie handelt? Um sog. Overblocking legaler Inhalte möglichst zu vermeiden, müssen die Diensteanbieter daher Verfahren einrichten, mit denen fälschlich geblockte Inhalte (wieder) "freigeschaltet" werden können. In diesem Seminar / Webinar wird es darum gehen, was in diesem Bereich künftig erlaubt und weiterhin verboten ist, und wie man Overblocking entgehen kann. Zudem wird gezeigt, wie ein fälschlich blockiertes Video oder eine fälsch blockierte Produktfotografie wieder "freigeschaltet" werden kann. Referent: Rechtsanwalt Dr. jur. Urs Verweyen Kostenlos!
Mit mehreren Urteilen vom 2. Juni 2022 hat der Bundesgerichtshof BGH unter Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung entscheiden, dass YouTube (Verfahren Az. I ZR 140/15, I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, I ZR 57/17 und I ZR 135/18) und der Sharehosting-Dienst uploaded (Verfahren Az. I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, I ZR 57/17 und I ZR 135/18) für User Generated Content und Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer ggf. als Täter, und nicht nur als Störer haften; dies hat v.a. zur Folge, dass YouTube und andere Sharehosting-Dienste etwaige Rechtsverletzungen nicht nur beseitigen und verhindern müssen, sondern grundsätzlich auch Schadensersatz schulden.
Zudem hat der BGH entschieden, das Uploadplattformen wie YouTube ihren Sorgfaltspflichten durch lediglich reaktive technische Maßnahmen, die Rechtsinhabern das Auffinden von bereits hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalten oder die Erteilung von darauf bezogenen Hinweisen an den Plattformbetreiber erleichtern, nicht genügen.
Insoweit sind künftig die Regeln des (neuen) Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG) zu beachten ... mehr Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle Nr. 080/2022 vom 02.06.2022 (Hervorhebungen hier) Zur Haftung von "YouTube" und "uploaded" für Urheberrechtsverletzungen Urteile vom 2. Juni 2022 – I ZR 140/15, I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, I ZR 57/17 und I ZR 135/18: Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in einem Verfahren über die Haftung des Betreibers der Internetvideoplattform "YouTube" und in sechs weiteren Verfahren über die Haftung des Betreibers des Internetsharehosting-Dienstes "uploaded" für von Dritten auf der Plattform bzw. unter Nutzung des Dienstes begangene Urheberrechtsverletzungen entschieden. Zum Verfahren I ZR 140/15: Sachverhalt: Der Kläger ist Musikproduzent. Er hat mit der Sängerin Sarah Brightman im Jahr 1996 einen Künstlerexklusivvertrag geschlossen, der ihn zur Auswertung von Aufnahmen ihrer Darbietungen berechtigt. Im November 2008 erschien das Studioalbum "A Winter Symphony" mit von der Sängerin interpretierten Musikwerken. Zugleich begann die Künstlerin die Konzerttournee "Symphony Tour", auf der sie die auf dem Album aufgenommenen Werke darbot. Die Beklagte zu 3 betreibt die Internetplattform "YouTube", auf die Nutzer kostenlos audiovisuelle Beiträge einstellen und anderen Internetnutzern zugänglich machen können. Die Beklagte zu 1 ist alleinige Gesellschafterin der Beklagten zu 3. Anfang November 2008 waren bei "YouTube" Videos mit Musikwerken aus dem Repertoire von Sarah Brightman eingestellt, darunter private Konzertmitschnitte und Musikwerke aus ihren Alben. Nach einem anwaltlichen Schreiben des Klägers sperrte die Beklagte zu 3 jedenfalls einen Teil der Videos. Am 19. November 2008 waren bei "YouTube" erneut Tonaufnahmen von Darbietungen der Künstlerin abrufbar, die mit Standbildern und Bewegtbildern verbunden waren. Der Kläger hat die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Bisheriger Prozessverlauf: Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich dreier Musiktitel stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Dritten in Bezug auf sieben näher bezeichnete Musiktitel zu ermöglichen, Tonaufnahmen oder Darbietungen der Künstlerin Sarah Brightman aus dem Studioalbum "A Winter Symphony" öffentlich zugänglich zu machen. Ferner hat es die Beklagten zur Erteilung der begehrten Auskunft über die Nutzer der Plattform verurteilt, die diese Musiktitel unter Pseudonymen auf das Internetportal hochgeladen haben. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Mit den vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revisionen verfolgt der Kläger seine Klageanträge weiter und erstreben die Beklagten die vollständige Abweisung der Klage. Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren mit Beschluss vom 13. September 2018 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat über die Fragen durch Urteil vom 22. Juni 2021 – C-682/18 und C-683/18 (YouTube und Cyando) entschieden. Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Der Bundesgerichtshof hat der Revision des Klägers stattgegeben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der Musiktitel auf dem Studioalbum "A Winter Symphony" und einiger auf der "Symphony Tour" dargebotener Musiktitel die gegenüber beiden Beklagten geltend gemachten Unterlassungsansprüche und die gegen die Beklagte zu 3 geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung abgewiesen hat. Der Revision der Beklagten hat der Bundesgerichtshof stattgegeben, soweit das Berufungsgericht sie zur Unterlassung und zur Auskunft über die E-Mail-Adressen von Nutzern verurteilt hat. Hinsichtlich der Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatzfeststellung hat der Bundesgerichtshof die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Die geltend gemachten Unterlassungsansprüche sind nur begründet, wenn die Bereitstellung von Nutzern hochgeladener rechtsverletzender Inhalte auf der von der Beklagten zu 3 betriebenen Plattform sowohl im Handlungszeitpunkt als auch nach der im Entscheidungszeitpunkt bestehenden Rechtslage eine die Rechte des Klägers verletzende öffentliche Wiedergabe darstellt. Das nach der Rechtslage im Handlungszeitpunkt maßgebliche Recht der öffentlichen Wiedergabe ist nach Art. 3 Abs. 1 und 2 Buchst. a und b der Richtlinie 2001/29/EG harmonisiert, so dass die entsprechenden Bestimmungen des deutschen Urheberrechtsgesetzes richtlinienkonform auszulegen sind. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat auf Vorlage des Senats entschieden, dass der Betreiber einer Video-Sharing-Plattform, der weiß oder wissen müsste, dass Nutzer über seine Plattform im Allgemeinen geschützte Inhalte rechtswidrig öffentlich zugänglich machen, selbst eine öffentliche Wiedergabe der von Nutzern hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalt im Sinne von Art. 3 Abs. 1 und 2 Buchst. a und b der Richtlinie 2001/29/EG vornimmt, wenn er nicht die geeigneten technischen Maßnahmen ergreift, die von einem die übliche Sorgfalt beachtenden Wirtschaftsteilnehmer in seiner Situation erwartet werden können, um Urheberrechtsverletzungen auf dieser Plattform glaubwürdig und wirksam zu bekämpfen. Lediglich reaktive technische Maßnahmen, die Rechtsinhabern das Auffinden von bereits hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalten oder die Erteilung von darauf bezogenen Hinweisen an den Plattformbetreiber erleichtern, genügen für die Einstufung als Maßnahmen zur glaubwürdigen und wirksamen Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen nicht. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass die allgemeine Kenntnis des Betreibers von der rechtsverletzenden Verfügbarkeit geschützter Inhalte auf seiner Plattform für die Annahme einer öffentlichen Wiedergabe des Betreibers nicht genügt, dass es sich aber anders verhalte, wenn der Betreiber, obwohl er vom Rechtsinhaber darauf hingewiesen wurde, dass ein geschützter Inhalt über seine Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurde, nicht unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um den Zugang zu diesem Inhalt zu verhindern. Der Bundesgerichtshof hält vor diesem Hintergrund für den durch Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG vollharmonisierten Bereich nicht an seiner Rechtsprechung fest, nach der in dieser Konstellation keine Haftung als Täter einer rechtswidrigen öffentlichen Wiedergabe, sondern allenfalls eine Haftung als Störer in Betracht kam. Hier tritt nun die Haftung als Täter an die Stelle der bisherigen Störerhaftung. Dabei sind die schon bisher für die Störerhaftung geltenden, an den Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung zu stellenden Anforderungen auf die Prüfung der öffentlichen Wiedergabe übertragbar. Der Gerichtshof hat weiter entschieden, dass der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, der allgemeine Kenntnis von der Verfügbarkeit von Nutzern hochgeladener rechtsverletzender Inhalte hat oder haben müsste, selbst eine öffentliche Wiedergabe der von Nutzern hochgeladenen rechtsverletzenden Inhalte vornimmt, wenn er ein solches Verhalten seiner Nutzer dadurch wissentlich fördert, dass er ein Geschäftsmodell gewählt hat, das die Nutzer seiner Plattform dazu anregt, geschützte Inhalte auf dieser Plattform rechtswidrig öffentlich zugänglich zu machen. Das Berufungsgericht hat keine hinreichenden Feststellungen zu der Frage getroffen, ob die Beklagte zu 3 die geeigneten technischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen auf ihrer Plattform ergriffen hat, die von einem die übliche Sorgfalt beachtenden Wirtschaftsteilnehmer erwartet werden können. Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen rechtfertigen auch nicht die Annahme, die Beklagte habe ihre durch einen Hinweis auf die klare Verletzung der Rechte des Klägers ausgelöste Pflicht verletzt, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu diesen Inhalten zu verhindern. Sofern das Berufungsgericht aufgrund der im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu treffenden Feststellungen zur Annahme einer öffentlichen Wiedergabe durch die Beklagte zu 3 gelangt, wird es weiter zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen einer öffentlichen Wiedergabe auch nach dem seit dem 1. August 2021 geltenden Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten (BGBl. I 2021 S. 1204) vorliegen. Zu den Verfahren I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, I ZR 57/17 und I ZR 135/18: Sachverhalt: Die Beklagte betreibt den Sharehosting-Dienst "uploaded" im Internet. Dieser Dienst bietet jedermann kostenlos Speicherplatz für das Hochladen von Dateien beliebigen Inhalts. Für jede hochgeladene Datei erstellt die Beklagte automatisch einen elektronischen Verweis (Download-Link) auf den Dateispeicherplatz und teilt diesen dem Nutzer automatisch mit. Die Beklagte bietet für die bei ihr abgespeicherten Dateien weder ein Inhaltsverzeichnis noch eine entsprechende Suchfunktion. Allerdings können Nutzer die Download-Links in sogenannte Linksammlungen im Internet einstellen. Diese werden von Dritten angeboten und enthalten Informationen zum Inhalt der auf dem Dienst der Beklagten gespeicherten Dateien. Auf diese Weise können andere Nutzer auf die auf den Servern der Beklagten abgespeicherten Dateien zugreifen. Der Download von Dateien von der Plattform der Beklagten ist kostenlos möglich. Allerdings sind Menge und Geschwindigkeit für nicht registrierte Nutzer und solche mit einer kostenfreien Mitgliedschaft beschränkt. Zahlende Nutzer haben, bei Preisen zwischen 4,99 € für zwei Tage bis 99,99 € für zwei Jahre, ein tägliches Downloadkontingent von 30 GB bei unbeschränkter Downloadgeschwindigkeit. Zudem zahlt die Beklagte den Nutzern, die Dateien hochladen, Downloadvergütungen, und zwar bis zu 40 € für 1.000 Downloads. Der Dienst der Beklagten wird sowohl für legale Anwendungen genutzt als auch für solche, die Urheberrechte Dritter verletzen. Die Beklagte erhielt bereits in der Vergangenheit in großem Umfang Mitteilungen über die Verfügbarkeit rechtsverletzender Inhalte von im Auftrag der Rechtsinhaber handelnden Dienstleistungsunternehmen. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten ist es den Nutzern untersagt, über die Plattform der Beklagten Urheberrechtsverstöße zu begehen. Die Klägerinnen in den Verfahren I ZR 53/17 und I ZR 54/17 sind Verlage, die Klägerinnen in den Verfahren I ZR 55/17 und I ZR 135/18 sind Musikunternehmen, die Klägerin im Verfahren I ZR 56/17 ist die GEMA und die Klägerin im Verfahren I ZR 57/17 ist ein Filmunternehmen. Die Klägerinnen sehen jeweils Rechtsverletzungen darin, dass über die externen Linksammlungen Dateien auf den Servern der Beklagten erreichbar seien, die Werke enthielten, an denen ihnen beziehungsweise im Verfahren I ZR 56/17 den Rechtsinhabern, deren Rechte die GEMA wahrnehme, Nutzungsrechte zustünden. Außer in den Verfahren I ZR 57/17 und I ZR 135/18 haben die Klägerinnen die Beklagte in erster Linie als Täterin, hilfsweise als Teilnehmerin und weiter hilfsweise als Störerin auf Unterlassung sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht beantragt. Im Verfahren I ZR 57/17 wird die Beklagte nur auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht und im Verfahren I ZR 135/18 auf Unterlassung und Erstattung von Rechtsanwaltskosten in Anspruch genommen. Bisheriger Prozessverlauf: In den Verfahren I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 56/17 und I ZR 57/17 haben die Landgerichte die Beklagte wegen Teilnahme an den Rechtsverletzungen zur Unterlassung verurteilt, sofern dies beantragt war, und den Anträgen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht stattgegeben. In den Verfahren I ZR 55/17 und I ZR 135/18 haben die Landgerichte die Beklagte als Störerin zur Unterlassung und im Verfahren I ZR 135/18 darüber hinaus zum Ersatz von Rechtsanwaltskosten verurteilt. Im Übrigen haben die Landgerichte die Klagen abgewiesen. Die Oberlandesgerichte haben angenommen, die Beklagte sei nur als Störerin zur Unterlassung und im Verfahren I ZR 135/18 zudem zum Ersatz von Rechtsanwaltskosten verpflichtet; im Übrigen haben sie die Klagen abgewiesen. In den Verfahren I ZR 53/17 und I ZR 135/18 haben die Oberlandesgerichte darüber hinaus angenommen, dass sich hinsichtlich einzelner Werke nicht feststellen lasse, dass die Beklagte diesbezüglich Prüfpflichten verletzt habe; insoweit haben sie die Klagen vollständig abgewiesen. Mit den im Verfahren I ZR 135/18 vom Oberlandesgericht und im Übrigen vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revisionen verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter. Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren I ZR 53/17 mit Beschluss vom 20. September 2018 (uploaded I) ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG vorgelegt (dazu Pressemitteilungen Nr. 156/2018 vom 20. September 2018). Die Verfahren I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, I ZR 57/17 und I ZR 135/18 hat der Bundesgerichtshof bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Verfahren I ZR 53/17 ausgesetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat auch über diese Fragen durch Urteil vom 22. Juni 2021 – C-682/18 und C-683/18 (YouTube und Cyando) entschieden. Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Der Bundesgerichtshof hat in sämtlichen Verfahren den Revisionen der Klägerinnen stattgegeben und die Sachen zur neuen Verhandlung und Entscheidung an die Berufungsgerichte zurückverwiesen. Für den Betreiber einer Sharehosting-Plattform gelten nach der Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union dieselben Grundsätze wie für den Betreiber einer Video-Sharing-Plattform. In den Verfahren I ZR 53/17, I ZR 54/17, I ZR 55/17, I ZR 56/17, und I ZR 57/17 bestehen gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Beklagte keine hinreichenden technischen Maßnahmen ergriffen hat, weil die von ihr eingesetzten proaktiven Maßnahmen (Stichwortfilter beim Download, Hashfilter, einige manuelle Kontrollen und Recherchen in Linkressourcen) Urheberrechtsverletzungen nicht hinreichend effektiv entgegenwirken und die weiteren von der Beklagten angeführten Maßnahmen (Bereitstellung eines "Abuse-Formulars" und eines "Advanced-Take-Down-Tools") lediglich reaktiv und daher ebenfalls unzureichend sind. Es bestehen zudem gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass das Geschäftsmodell der Beklagten auf der Verfügbarkeit rechtsverletzender Inhalte beruht und die Nutzer dazu verleiten soll, rechtsverletzende Inhalte über die Plattform der Beklagten zu teilen. Für eine abschließende Beurteilung sind allerdings noch tatsächliche Feststellungen zu treffen. Sind die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach dem im Handlungszeitpunkt geltenden Recht begründet, ist zudem zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer öffentlichen Wiedergabe auch nach dem seit dem 1. August 2021 geltenden Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten vorliegen. Im Verfahren I ZR 135/18 sind nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen die Voraussetzungen einer öffentlichen Wiedergabe der Beklagten nach der Rechtslage im Handlungszeitpunkt erfüllt, weil die Beklagte ihre durch den Hinweis auf die klare Verletzung der Rechte der Klägerin am genannten Musikalbum ausgelöste Pflicht verletzt hat, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu diesen Inhalten zu verhindern. Die durch den Hinweis der Klägerin ausgelöste Prüfungspflicht umfasste sowohl die Pflicht zur unverzüglichen Verhinderung des Zugangs zur konkret beanstandeten Datei und zu weiteren, im Zeitpunkt der Beanstandung bereits hochgeladenen gleichartigen rechtsverletzenden Inhalten als auch die Pflicht zur Vorsorge, dass es künftig nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt. Auch hier ist allerdings noch zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer öffentlichen Wiedergabe nach dem seit dem 1. August 2021 geltenden Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten vorliegen. Vorinstanzen: I ZR 140/15 – YouTube II LG Hamburg – Urteil vom 3. September 2010 – 308 O 27/09 OLG Hamburg – Urteil vom 1. Juli 2015 – 5 U 175/10 und I ZR 53/17 – uploaded II LG München I – Urteil vom 18. März 2016 – 37 O 6199/14 OLG München – Urteil vom 2. März 2017 – 29 U 1797/16 Und I ZR 54/17 LG München I – Urteil vom 31. März 2016 – 7 O 6201/14 OLG München – Urteil vom 2. März 2017 – 29 U 1818/16 und I ZR 55/17 LG München I – Urteil vom 31. Mai 2016 – 33 O 6198/14 OLG München – Urteil vom 2. März 2017 – 29 U 2874/16 und I ZR 56/17 LG München I – Urteil vom 10. August 2016 – 21 O 6197/14 OLG München – Urteil vom 2. März 2017 – 29 U 3735/16 und I ZR 57/17 LG München I – Urteil vom 31. März 2016 – 7 O 6202/14 OLG München – Urteil vom 2. März 2017 – 29 U 1819/16 und I ZR 135/18 – uploaded III LG Hamburg – Urteil vom 7. Juli 2016 – 310 O 208/15 OLG Hamburg – Urteil vom 28. Juni 2018 – 5 U 150/16 Die maßgeblichen Vorschriften lauten: Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu verbieten. § 19a UrhG: Recht der öffentlichen Zugänglichmachung Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. § 97 UrhG: Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz (1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. (…) (2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (…)
(YouTube I) ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt und der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgelegt (dazu Pressemitteilungen Nr. 150/2018 vom 13. September 2018).
Das Landgericht Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 18. Mai 2022, Az. 2-06 O 52/21, entschieden, dass dem Gestalter der Darstellung des europäischen Kontinents auf den Euro-Geldscheinen kein Nachvergütungsanspruch nach § 32a UrhG (sog. Fairnessausgleich) zusteht, weil die Darstellung auf den Euro-Banknoten keine unfreie Bearbeitung seiner Entwürfe i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG (n.F.) sei, sondern einen hin hinreichenden Abstand davon wahre; ähnlich hatte jüngst der Bundesgerichtshof hins. des Porsche 911 (8. Baureihe 991) im Verhältnis zum "Ur-Porsche" 356 entschieden: ... mehr Pressemitteilung des LG Frankfurt a.M. vom 25.05.2022: Abbildung des europäischen Kontinents auf Euro-Banknoten, Urheber der Bilddatei steht keine Nutzungsvergütung zu Das Landgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass der Urheber des Bildes von Europa, das auf allen Euro-Banknoten in abgewandelter Form verwendet wird, keine Vergütung für die Nutzung verlangen kann. Der Kläger ist Geograf und Karthograph. Er hatte eine Abbildung des europäischen Kontinents erstellt und dafür verschiedene Satellitenbilder und digitale Dateien verwendet, bearbeitet und verändert, Küstenlinien, Fjorde und Inseln verschoben und Oberflächenstrukturen und Farben überarbeitet. Das so geschaffene Bild wurde im Rahmen eines 1996 ausgetragenen Wettbewerbs um die Gestaltung der Euro-Banknoten in dem letztlich als Sieger auserkorenen Entwurf verwendet. Der Kläger übertrug einer europäischen Institution die Nutzungsrechte an der bearbeiteten Satellitenaufnahme und erhielt dafür 2.180 €. Später wurde die Lizenz zur Nutzung des Bildes auf die Europäische Zentralbank übertragen. Der Kläger hat verlangt, dass die Europäische Zentralbank ihm eine sog. angemessene Vergütung bzw. Nachvergütung nach dem Urhebergesetz zahlt. Für die Vergangenheit hat er 2,5 Mio. Euro gefordert und zusätzlich jährlich 100.000 Euro für die Dauer von weiteren 30 Jahren. Das Landgericht Frankfurt am Main hat die Klage abgewiesen. Eine Vergütung nach dem Urhebergesetz sei ausgeschlossen, weil ein Werk des Klägers tatsächlich nicht genutzt werde. Die Richterinnen und Richter erklärten in ihrem Urteil: „Zwar wird die Bilddatei des Klägers als Ausgangsprodukt für die Gestaltung verwendet, indem die Satellitenansicht Europas in ihren Umrissen übernommen wird." Jedoch weiche die Darstellung auf den Euro-Banknoten so stark von dem Satellitenbild des Klägers ab, dass ein selbständiges, neues Werk geschaffen worden sei. Maßgeblich sei, ob „die dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge im neuen Werk zurücktreten, sodass die Benutzung des älteren Werkes durch das neue nur noch als Anregung zu einem neuen, selbständigen Werkschaffen erscheint." Das sei vorliegend der Fall: „Bei einem Gesamtvergleich der Bilddatei mit den Euro-Banknoten ist ein Verblassen der eigenschöpferischen Merkmale der Bilddatei anzunehmen." Denn der europäische Kontinent werde nur auf einem verhältnismäßig geringen Teil der Banknoten dargestellt. Auf dem Bild des Klägers seien die Landmassen Europas außerdem in naturtypischer Darstellung in grün und dunkelbraun gehalten, während der Kontinent auf den Euro-Banknoten in der jeweiligen Grundfarbe der Stückelung nur einfarbig mit Linienreliefs gestaltet werde. Schließlich sei auf den Geldscheinen von der für eine Satellitenaufnahme prägenden Darstellung der Lebensumwelt, insbesondere der Höhen und Tiefen der Landschaftselemente, vollständig Abstand genommen worden. Das Urteil vom 18.5.2022 (Aktenzeichen: 2-06 O 52/21) ist nicht rechtskräftig. Zur Erläuterung § 32 Absatz 1 Urhebergesetz: „Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. (…)" § 32a Absatz 1 Urhebergesetz: „Hat der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung sich unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen als unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes erweist, so ist der andere auf Verlangen des Urhebers verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, durch die dem Urheber eine den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung gewährt wird. (…)" § 23 Absatz 1 Urhebergesetz: „Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes (…) dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht werden. Wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des Satzes 1 vor." Am 6. Julio 2022 wurde der Volltext der Entscheidung veröffentlicht: "Sowohl der Anspruch auf angemessene Vergütung nach § 32 UrhG als auch der sogenannte Nachvergütungsanspruch auf weitere Beteiligung des Urhebers nach § 32a UrhG setzen voraus, dass ein Vergütungsanspruch für eine Erlaubnis zur Werknutzung geltend gemacht wird bzw. der Vertragspartner des Urhebers dessen Werk tatsächlich nutzt. Das ist nicht der Fall. Die Beklagte nutzt die Darstellung des … Kontinents auf der vom Kläger geschaffenen Bilddatei auf den …-… der ersten und der zweiten Serie nicht. Vielmehr stellen die Abbildungen des … Kontinents auf den … sogenannte freie Bearbeitungen im Sinne von § 23 UrhG dar, die einen hinreichenden Abstand zu der vom Kläger geschaffenen Abbildung wahren. Die …-… der ersten und zweiten Serie weichen in ihrem Aussehen so stark von der Bilddatei des Klägers ab, dass sie urheberrechtlich als neu geschaffene Werke mit hinreichendem Abstand im Sinne des § 23 Abs. 1 (2) UrhG zu sehen sind. Bei der Frage, ob in freier Benutzung eines geschützten älteren Werkes ein selbständiges neues Werk geschaffen worden ist, kommt es entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält. Dies setzt voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen (BGH, Urt. v. 11.03.1993, I ZR 263/91, Rn. 19 – Alcolix; BGH, Urt. v. 29.04.1991, I ZR 65/96, Rn. 43 – Laras Tochter; BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 12/08, Rn. 33 – Perlentaucher, Perlentaucher I). In der Regel ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn die dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge im neuen Werk zurücktreten, sodass die Benutzung des älteren Werkes durch das neuere nur noch als Anregung zu einem neuen, selbständigen Werkschaffen erscheint (BGH, Urt. v. 11.03.1993, I ZR 263/91, Rn. 19 – Alcolix; BGH, Urt. v. 29.04.1991, I ZR 65/96, Rn. 43 – Laras Tochter; BGH, Urt. v. 01.12.2010, I ZR 12/08, Rn. 33 – Perlentaucher, Perlentaucher I). Ob dies der Fall ist, hängt nicht zuletzt vom Grad der Individualität der entlehnten Züge einerseits und des neuen Werkes andererseits ab. Es herrscht eine Wechselwirkung. Je auffallender die Eigenart des benutzten Werkes ist, umso weniger werden dessen übernommene Eigenheiten in dem danach geschaffenen Werk verblassen (BGH, Urt. v. 12.06.1981 – I ZR 95/79, Rn. 28 – WK-Dokumentation). Umgekehrt ist von einer freien Bezeichnung dort eher auszugehen, wo sich die Eigenart des neuen Werkes gegenüber dem älteren Werk in besonderem Maße abhebt. Zur Prüfung, ob ein hinreichender Abstand vorliegt, ist zunächst festzustellen, welche objektiven Merkmale im Einzelnen die schöpferische Eigentümlichkeit des benutzten Werkes bestimmen. Sodann ist durch Vergleich der sich gegenüberstehenden Werke zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang im neuen Werk eigenschöpferische Züge des älteren Werkes übernommen worden sind. Maßgebend für die Entscheidung ist letztlich ein Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestaltungen, in dessen Rahmen sämtliche übernommenen schöpferischen Züge in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind (BGH, Urt. v. 08.07.2004, I ZR 25/02, Rn. 33 – Hundefigur, BGH, Urt. v. 01.06.2011, I ZR 140/09, Rn. 48 – Lernspiele). Bei übereinstimmendem Gesamteindruck hängt es von der Wesentlichkeit der Veränderung ab, ob es sich um eine reine Vervielfältigung (§ 16 UrhG) oder um eine unfreie Benutzung (§ 23 UrhG) handelt (BGH, Urt. v. 16.05.2013, I ZR 28/12, Rn. 36 – Beuys-Aktion; 28.06, 2016, I ZR 9/15, Rn. 21 – auf fett getrimmt).Bei abweichendem Gesamteindruck kommt demgegenüber eine freie Benutzung in Betracht, die voraussetzt, dass die Veränderung der benutzten Vorlage so weitreichend ist, dass die Nachbildung über eine eigene schöpferische Ausdruckskraft verfügt und die entlehnten eigenpersönlichen Züge des Originals angesichts der Eigenart der Nachbildung verblassen (BGH, Urt. v. 16.05.2013, I ZR 28/12, Rn. 37, Beuys-Aktion). Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe besteht ein hinreichender Abstand der streitgegenständlichen …-… zu der klägerischen Bilddatei."
Mit Urteil vom 19. Mai 2022, Az. 6 U 56/21hat das OLG Frankfurt entschieden, dass ein Beitrag (Post) einer Influencerin auf Instagram, in dem kostenlos überlassene eBooks angepriesen und mit sog. Tap-Tags auf die Instragram-Accounts der Unternehmen verlinkt werden, auch dann als Werbung zu kennzeichnen ist, wenn der Post ohne finanzielle Gegenleistung erfolgt (vgl. bereits BGH, Urt. v. 13.01.2022 – I ZR 35/21 – Influencer III). Aufgrund der Vermischung von privaten und kommerziellen Darstellungen sei es für den Durchschnittsverbraucher ohne diese Kennzeichnung nicht erkennbar, dass es sich um Werbung handelt.
... mehr OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN Anpreisung kostenlos erhaltener Bücher durch Influencerin auf Instagram mit Verlinkung zu den Unternehmen über Tap-Tags ist als Werbung kenntlich zu machen 19.05.2022 Pressestelle: OLG Frankfurt am Main Nr. 42/2022 Ein ohne finanzielle Gegenleistung erfolgter Beitrag einer Influencerin auf Instagram ist als Werbung zu kennzeichnen, wenn er kostenlos überlassene E-Books anpreist und jeweils mit sog. Tap-Tags zu den Unternehmen der Bücher verlinkt. Aufgrund der Vermischung von privaten und kommerziellen Darstellungen ist es für den Durchschnittsverbraucher ohne diese Kennzeichnung nicht erkennbar, ob es sich um Werbung handelt. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) wies mit heute verkündetem Urteil die Berufung einer Influencerin zurück, die vom Landgericht zum Unterlassen der Veröffentlichung derartiger Posts ohne Werbehinweis verurteilt worden war. Die Klägerin ist Verlegerin mehrerer Print- und Onlinezeitschriften. Sie verfügt über einen Instagram-Account und bietet Kunden u.a. entgeltlich Werbeplatzierungen an. Die Beklagte ist sog. Influencerin und betreibt auf Instragram ein Nutzerprofil mit mehr als einer halbe Million Followern. Sie stellt dort zum einen Produkte und Leistungen von Unternehmen vor, für deren Präsentation sie von diesen vergütet wird. Zum anderen veröffentlicht sie Posts, bei denen sie mittels sog. Tap-Tags auf die Instragram-Accounts von Unternehmen verlinkt, deren Produkte zu sehen sind. Hierfür erhält sie keine finanzielle Gegenleistung. Im Herbst 2019 verwies die Beklagte auf ein Bündel von E-Books, das sich mit veganer Ernährung befasste. Sie erhielt dafür keine finanzielle Gegenleistung; die E-Books waren ihr jedoch kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Das Landgericht verurteilte die Beklagte, es zu unterlassen, kommerzielle Inhalte vorzustellen, ohne die Veröffentlichung als Wertung kenntlich zu machen. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg. Der Klägerin stehe der geltend gemacht Unterlassungsanspruch wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu, begründete das OLG seine Entscheidung. Die Parteien seien Mitbewerber. Beide böten Dritten an, auf ihrem Instagram-Account entgeltlich zu werben. Die Posts der Beklagten seien auch geschäftliche Handlungen. Erfasst würden Handlungen, die bei objektiver Betrachtung darauf gerichtet seien, durch „Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung der Verbraucher, den Absatz oder Bezug von Waren oder Dienstleistungen des eigenen oder eines fremden Unternehmens zu fördern", betont das OLG. Der Betrieb des Instagram-Profils fördere zum einen das eigene Unternehmen der Beklagten. Die Steigerung des Werbewerts komme unmittelbar ihrem Unternehmen zugute. Gerade scheinbar private Posts machten es für das Publikum attraktiver, Influencern zu folgen, da diese so „glaubwürdiger, nahbarer und sympathischer" wirkten. Zum anderen fördere der Post auch die Unternehmen der Anbieter der E-Books. Es liege ein „geradezu prototypischer Fall des werblichen Überschusses" vor. Es finde keinerlei Einordnung oder inhaltliche Auseinandersetzung oder Bewertung der herausgestellten Produkte statt. Die Beklagte habe vielmehr werbend unter Hervorhebung des außergewöhnlich hohen Rabattes die E-Books angepriesen. Diese Förderung der Drittunternehmen nicht kenntlich zu machen, sei unlauter. Die Beklagte habe die E-Books im von ihr behaupteten Wert von rund 1.300 € unentgeltlich erhalten und dies nicht gekennzeichnet. Die Kennzeichnung als Werbung sei auch nicht entbehrlich gewesen. „Selbst followerstarke Profile auf Instagram sind nicht stets (nur) kommerziell motiviert", erläutert das OLG, so dass die Follower zu Recht erwarteten, dass ein etwaiges ernährungsbezogenes Engagement des Influencers nicht kommerziell beeinflusst sei. Die Beklagte habe allerdings nicht darauf hinweisen müssen, dass ihr Verhalten auch ihrem Unternehmen zu gute komme. Dies sei dem durchschnittlichen Verbraucher unzweifelhaft erkennbar gewesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Mit der Nichtzulassungsbeschwerde kann der Kläger die Zulassung der Revision beim BGH begehren. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 19.5.2022, Az. 6 U 56/21
(vorausgehend LG Frankfurt am Main, Urteil vom 31.3.2021, Az. 2/6 O 271/20)
Die Entscheidung ist in Kürze unter www.rv.hessenrecht.hessen.de abrufbar.
Die Kanzlei Gutsch & Schlegel aus Hamburg mahnt erneut massenhaft Medienhändler und Online-Antiquariate/recommerce-Anbieter wegen des Verkaufs sogenannter Bootlegs (nicht lizenzierte Aufnahmen, meist Mitschnitte von Live-Aufnahmen) ab, zur Zeit vermehrt für den Musiker Elvis Costello (Declan Patrick Aloysius MacManus). Rechtsanwälte Gutsch & Schlegel macht Ansprüche auf Unterlassen und Vernichtung, Auskunft und Schadensersatz sowie Kostenersatz (Kosten für die Abmahnung) geltend. Es lohnt sich, diese Abmahnungen genau zu prüfen/prüfen zu lassen und keine vorschnellen Zugeständnisse zu machen. Grundsätzlich muss der (angebliche) Rechteinhaber bzw. Rechtsanwälte Gutsch & Schlegel den behaupteten Rechtsverstoß (Bootlegs, Piracy, Grau-/Parallelimport, etc.) genau nachweisen und dazu insb. die Rechteinhaberschaft und Anspruchsberechtigung lückenlos über die gesamte Rechtekette nachweisen. ... mehr Verschiedentlich habe sich die Abmahnungen von Rechtsanwälten Gutsch & Schlegel auch als rechtsmissbräuchlich erwiesen! So hat der Bundesgerichtshof BGH mit Urteil vom 28. Mai 2020, Az. I ZR 129/19, eine Abmahnung der Kanzlei Gutsch & Schlegel anhand mehrerer Kriterien als rechtsmissbräuchlich und damit als "nicht berechtigt" i.S.v. § 97a Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 4 UrhG befunden und hat die auf Ersatz der Kosten für die Abmahnung gerichtete Klage der Kanzlei Gutsch & Schlegel vollumfänglich abgewiesen! Auch in Bezug auf die geltend gemachte Erstattung der Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzforderungen lohnt ein genauer Blick. Insbesondere ist die außergerichtliche Inanspruchnahme mehrerer Schädiger nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebührenrechtlich i.d.R. als eine Angelegenheit anzusehen, sodass i.d.R. nur ein Bruchteil der von Gutsch & Schlegl regelmäßig eingeforderten Gebühren erstattet werden muss (Urteil BGH – Der Novembermann; erneut BGH, Urteil vom 22.01.2019, Az. VI ZR 402/17 – Ermittlungen gegen Schauspielerin). Kosten für die Ermittlung der angeblichen Rechtsverletzung durch die GUMPS GmbH (Geschäftsführer sind auch hier die Rechtsanwälte Gutsch und Schlegel)sind i.d.R. ebenfalls nicht geschuldet, und wurden von den Gerichten bereits in mehreren Verfahren zurückgewiesen. Rechtsanwälte Gutsch & Schlegel gehen zudem auch wegen angeblicher Bootleg-Aufnahmen der Musiker/Musikgruppen u.a. gegen Medienhändler, Online-Antiquariate und Gebraucht-Medien-Händler (recommerce), sowie gegen private Anbieter (eBay-Verkäufe), vor. In den meisten Fällen konnten wir erreichen, dass gegen unsere Mandanten keine Klagen eingereicht wurden und Kosten und Schadensersatzforderungen außergerichtlich abwehren. Zudem konnten wir Klagen meist erfolgreich abwehren, u.a. Klagen betreffend die Musikgruppen/Musiker Iron Maiden, Genesis, Phil Collin; Klagen der Kanzlei Gutsch & Schlegel wurden in diesen Fällen abgewiesen (Amts- und Landgericht Hamburg).
Mit Urteil vom 05.01.2022, Az. 30 C 4113/20 (47) hat das Amtsgericht Frankfurt a.M. entschiednen dass bei einer unterlassenen Namensnennung des Fotografen (vgl. § 13 UrhG) dann kein Schadensersatz nach sich zieht, wenn der Fotograf dadurch keinen Nachteile, insb. einen entgangenen Werbeeffekt und entgangene Aufträge, erleidet. ... mehr Streitgegenständlich waren zwei Fotografien mit Stadtansichten, die der Fotograf auf Wikimedia mit GNU-Lizenz für freie Dokumentation und der Creative-Commons-Lizenz 'Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert' eingestellt hatte. Die Klägerin (der negativen Feststellungsklage) hatte die Bilder auf ihrer eigenen Internetseite genutzt, ohne den Fotografen zu nennen. Das Amtsgericht Frankfurt a.M. konnte hier keinen ersatzfähigen Schaden erkennen: "Dennoch ist kein in Geld bezifferbarer Schaden entstanden. Zwar würden in Fällen wie dem vorliegenden die Lizenzpartner grundsätzlich eine Lizenzgebühr vereinbaren, da die Verwendung ohne Namensnennung einen Vorteil des Verwenders darstellt (OLG Frankfurt am Main ZUM-RD 2020, 443). Grundlage für die Schadensermittlung ist jedoch der Verlust, den der Urheber durch den entgangenen Werbeeffekt erleidet (OLG Frankfurt am Main ZUM-RD 2020, 443). Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass dem Beklagten Aufträge dadurch entgangen sind, dass die Klägerin seine Bilder verwendete. Es handelt sich nicht um Bilder, die sich von zahlreichen anderen Stadtansichten abheben würden oder sonst einen besonderen Werbewert hätten. Gerade bei derlei Fotografien ist nicht ohne weitere Anhaltspunkte davon auszugehen, dass Dritte bei Betrachtung der Fotos unter Nennung des Namens des Urhebers nach diesem gesucht und ihm Aufträge erteilt hätten. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin durch die Verwendung der Bilder einen Gewinn erzielte, der unter dem Gesichtspunkt des Verletzergewinns herauszugeben wäre."
In diesem Webinar am 18.Mai 20220, ab 11:00 Uhr, beschäftigen wir uns mit dem "neuen" Urheberrecht und Urheberrechtsdiensteanbieter-Gesetz (UrhDaG). Neben den Veränderungen für Urheberrinnen und Urheber können sich Nutzer künftig auf neue Freiheiten berufen. Das wird die Konzeption und Durchführung von Social-Media-Kampagnen auf Instagram, Facebook, Pinterest oder anderen „Diensteanbietern" erheblich beeinflussen. Mit dem neu eingeführten Pastiche und den ausgeweiteten Schranken der Parodie, der Karikatur und des Zitatrechts sind neue Spielräume entstanden, die Designerinnen und Designer kennen müssen. ... mehr In dem Webinar wird RA Dr. Urs Verweyen anhand praktischer Bespiele erläutern, was künftig in den Sozialen Medien und im Internet möglich ist und wo die Grenzen der freien Nutzungen liegen, z.B. Referent Rechtsanwalt Dr. Urs Verweyen ist seit über 15 Jahre als Rechtsanwalt im Bereich des Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechts tätig; er ist ehemaliger AGD-Justiziar und neuerdings AGD-Vertragsanwalt.
Mit Urteil vom 26. April 2022 in der Rechtssache C 410/19 – Polen ./. europ. Parlament und Rat hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die in Art. 17 der DSM-Richtlinie 2019/790 angelegte Verpflichtung von Plattformen für Nutzerinhalte (user generated content) Uploadfilter einzurichten, grundsätzlich mit den Grundrechten auf Meinungs- und Informationsfreiheit vereinbar ist. ... mehr Demnach ist die Verpflichtung der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, die Inhalte, die Nutzer auf ihre Plattformen hochladen wollen, vor ihrer öffentlichen Verbreitung zu überprüfen, nach Art. 17 DSM-RiL "mit den erforderlichen Garantien verbunden, um ihre Vereinbarkeit mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit zu gewährleisten." Aus Art. 17 der DSM-RiL folgt der Grundsatz, dass Diensteanbieter (Plattformen) unmittelbar haften, wenn urheberrechtliche Geschütze Werke von den Nutzern eines solchen Dienstes rechtswidrig auf die Plattform hochgeladen werden. Die Plattformen können sich jedoch von dieser Haftung freikaufen, in dem sie die von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte aktiv überwachen und blocken (filtern), um so das rechtswidrige Hochladen von Inhalten zu verhindern. Kritiker fürchten, dass es dadurch zu einem massiven "Overblocking" und gravierenden Einschränkungen der Meinungs- und Informationsfreiheit – "Zensurheberrecht 2.0". Die Verpflichtung zur Einrichtung von Uploadfiltern wurde in Deutschland im neuen Urheberrechts-Diensteantbieter-Gesetze (UrhDaG, Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten) umgesetzt (ob gut, sei dahingestellt; ob verfassungskonform und vereinbar mit der DSM-RiL ist durch die heutige Entscheidung des EuGH zur DSM-RiL nicht gesagt). Bericht bei heise.
Mit Urteil vom 7. April 2022, Az. I ZR 222/20, hat der Bundesgerichtshof BGH, wie schon das Landgericht Stuttgart, entschieden, dass der Tochter des Sportwagen-Konstrukteurs Erwin Franz Komenda kein Anspruch auf eine angemessene weitere Vergütung nach § 32a UrhG (sog. Fairnessausgleich) gegen die Porsche AG insoweit zusteht, als sie ihre Klage darauf gestützt hatte, dass die jüngeren Modelle des Porsche 911 (Baureihe 991) gestalterisch auf dem von Ihrem Vater gestalteten Modell Porsche 356 beruhen. ... mehr Zwar sei die Gestaltung des Porsche 356 als Werk der angewandten Kunst nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG urheberrechtlich geschützt und der Vater der Klägerin, Erwin Franz Komenda, sei als Schöpfer dieses Werks anzusehen. Bei einem Vergleich des Gesamteindrucks der beiden Porsche-Modelle seien aber die den Urheberrechtsschutz des Porsche 356 begründenden gestalterischen Elemente in der Gestaltung des Porsche 911 der Baureihe 991 nicht wiederzuerkennen, sodass die Porsche AG mit dem Vertrieb des jüngeren 911er-Modells nicht in entsprechende Rechte des Urhebers eingegriffen habe. Ein Anspruch auf einen weitere angemessene Beteiligung scheide deshalb aus. Offen gelassen hat der BGH dabei, ob es sich auch mit dem Porsche 911 der Baureihe 991 um ein urheberrechtlich geschütztes Werk der angewandten Kunst nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG handelt und damit die Voraussetzungen einer freien Benutzung im Sinne von § 24 Abs. 1 UrhG a.F. bzw. § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG n.F. vorliegen. Nicht entschieden hat der BGH, ob der Klägerin Nachvergütungsansprüche deswegen zustehen, weil die Porsche AG mit dem Vertrieb des Porsche 911 der Baureihe 991 Urheberrechte ihres Vaters an dem "Ur-" Porsche 911 genutzt haben soll. Insoweit hatte die Klägerin nach Ansicht Oberlandesgerichts Stuttgart nicht nachgewiesen, dass ihr Vater Erwin Franz Komenda die äußere Gestaltung des Ur-Porsche 911 geschaffen habe. Dabei hat das OLG Stuttgart allerdings ein Beweisangebot der Klägerin übergangen, aus dem sich zumindest ein Indiz für die Urheberschaft Komedas hätte ergeben können. Der BGH hat das Verfahren daher insoweit an das OLG Stuttgart zurückverwiesen. Zum Verfahren vor dem LG Stuttgart s. Urs Verweyen: Anmerkung zu LG Stuttgart, Urt. v. 26.7.28, Az. 17 O 1324/17 – Kein Anspruch der Erbin des Konstrukteurs und Designers des "Ur-Porsches" auf Nachvergütung / Fairnessausgleich nach § 32a UrhGm JurPC Web-Dok. 137/2018, Abs. 1 – 12. Zum Parallelverfahren betreffend den VW Käfer / VW Beetle s. hier. Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle Nr. 045/2022 vom 07.04.2022 Bundesgerichtshof zu urheberrechtlichen Ansprüchen eines Konstrukteurs der Porsche AG auf Fairnessausgleich nach § 32a UrhG Urteil vom 7. April 2022 – I ZR 222/20 – Porsche 911 Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über urheberrechtliche Beteiligungsansprüche des früheren Abteilungsleiters der Karosserie-Konstruktion der Porsche AG am wirtschaftlichen Erfolg des Porsche 911 entschieden. Sachverhalt: Die Beklagte ist die Porsche AG. Die Klägerin ist die Tochter eines im Jahr 1966 verstorbenen Abteilungsleiters der Rechtsvorgängerin der Beklagten. Dieser war im Rahmen seiner Tätigkeit mit der Entwicklung des ab 1950 produzierten Fahrzeugmodells Porsche 356 und dessen seit 1963 gebauten Nachfolgemodells Porsche 911 befasst. Der Umfang seiner Beteiligung an der Gestaltung dieser Modelle ist zwischen den Parteien streitig. Bisheriger Prozessverlauf: Die Klägerin verlangt als Erbin ihres Vaters und aus abgetretenem Recht einer weiteren Erbin von der Beklagten gemäß § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG ab dem 1. Januar 2014 eine angemessene Beteiligung an den Erlösen aus dem Verkauf der ab 2011 produzierten Baureihe 991 des Porsche 911. Sie meint, bei den Fahrzeugen dieser Baureihe seien wesentliche Gestaltungselemente der unter maßgeblicher Beteiligung ihres Vaters entwickelten Ursprungsmodelle des Porsche 356 und des Porsche 911 übernommen worden. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Das Oberlandesgericht hat allerdings im Ergebnis mit Recht angenommen, dass der Klägerin keine Ansprüche auf weitere angemessene Beteiligung gemäß § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG zustehen, soweit sie geltend macht, die Beklagte habe mit dem Vertrieb der Baureihe 991 des Porsche 911 die Urheberrechte ihres Vaters am Porsche 356 genutzt. Die Gestaltung des Porsche 356 ist zwar als Werk der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG). Die Klägerin hat auch nachgewiesen, dass ihr Vater diese Gestaltung geschaffen hat und damit deren Urheber ist (§ 7 UrhG). Die Beklagte hat mit dem Vertrieb der Baureihe 991 des Porsche 911 aber nicht das ihr vom Vater der Klägerin im Rahmen des Arbeitsverhältnisses eingeräumte Recht zur Verwertung dieses Werkes in körperlicher Form (§ 15 Abs. 1 UrhG) genutzt. Nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts sind bei einem Vergleich des Gesamteindrucks der beiden Fahrzeugmodelle die den Urheberrechtsschutz des Porsche 356 begründenden Elemente in der Gestaltung des Porsche 911 nicht mehr wiederzuerkennen. Die Beklagte hat daher mit der Herstellung und dem Vertrieb des Porsche 911 nicht in das ausschließliche Recht des Urhebers zur Vervielfältigung (§ 16 Abs. 1 UrhG) und Verbreitung (§ 17 Abs. 1 UrhG) des Porsche 356 eingegriffen. Ein Anspruch auf weitere angemessene Beteiligung scheidet deshalb aus, ohne dass es darauf ankommt, ob es sich bei der Gestaltung der Baureihe 991 des Porsche 911 gleichfalls um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt und damit die Voraussetzungen einer freien Benutzung im Sinne von § 24 Abs. 1 UrhG aF/§ 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG nF vorliegen. Die Annahme des Oberlandesgerichts, der Klägerin stünden auch keine Ansprüche auf weitere angemessene Beteiligung zu, soweit sie sich darauf berufe, die Beklagte habe mit dem Vertrieb der Baureihe 991 des Porsche 911 die Urheberrechte ihres Vaters am Ursprungsmodell des Porsche 911 genutzt, hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen in einem entscheidenden Punkt nicht stand. Das Oberlandesgericht hat Ansprüche der Klägerin mit der Begründung abgelehnt, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass ihr Vater die äußere Gestaltung der Karosserie des Porsche 911 geschaffen habe. Die Klägerin hatte im Berufungsverfahren allerdings ihren Ehemann als Zeugen dafür benannt, dass ihr Vater diesem bei einem Besuch an seinem Arbeitsplatz klargemacht habe, dass der Porsche 911 und dessen Karosserie "sein Auto, sein Entwurf" gewesen sei. Das Oberlandesgericht hätte sich mit diesem Beweisangebot auseinandersetzen müssen, weil die Zeugenaussage zumindest ein Indiz für die Urheberschaft des Vaters der Klägerin liefern konnte. Die Klägerin hat dieses Beweisangebot zwar erst nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist vorgebracht. Das Oberlandesgericht hat sich aber nicht damit befasst, ob die Klägerin deshalb mit ihrem Beweisantritt ausgeschlossen ist. Diese Frage kann nur vom Berufungsgericht und nicht vom Revisionsgericht entschieden werden. Vorinstanzen: LG Stuttgart – Urteil vom 26. Juli 2018 – 17 O 1324/17 OLG Stuttgart – Urteil vom 20. November 2020 – 5 U 125/19 Die maßgeblichen Vorschriften lauten: § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: … 4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke; … (2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. § 7 UrhG Urheber ist der Schöpfer des Werkes. § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UrhG (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfasst insbesondere 1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 2. das Verbreitungsrecht (§ 17), … § 16 Abs. 1 UrhG (1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. § 17 Abs. 1 UrhG (1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. § 23 Abs. 1 UrhG nF (1) Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen eines Werkes, insbesondere auch einer Melodie, dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden. Wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des Satzes 1 vor. § 24 Abs. 1 UrhG aF Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. § 32a Abs. 1 Satz 1 UrhG (1) Hat der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Bedingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung sich unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen als unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes erweist, so ist der andere auf Verlangen des Urhebers verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, durch die dem Urheber eine den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung gewährt wird.
Mit Urteil vom 2. November 2021, Az. 15 O 551/19 (nicht rechtskräftig) hat das Landgericht Berlin, soweit ersichtlich: als erste Gericht überhaupt, die neue "Pastiche"-Schranke des § 51a UrhG (in der seit Sommer 2021 gültigen Fassung) angewendet, und befunden, dass die Übernahme auch einer ganzen, als Werk urheberrechtlich geschützten Computergrafik in ein Gemälde als Pastiche erlaubnis- und vergütungsfrei zulässig sein kann. Im Streitfall hatte der Berliner Maler Martin Eder die Computergrafik "Scorched Earth" des Künstler Daniel Conway in sein collagenhaftes Gemälde "The Unknowable" übernommen. ... mehr Das LG Berlin hat dabei zugunsten des Klägers unterstellt, dass die Computergrafik urheberrechtlichen Schutz genießt: "Es kann für die Entscheidung offengelassen werden, ob der Kläger der Urheber des Computerbildes "Scorched Earth" …ist, ob dieses Bild schutzfähig im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG ist und ob der Kläger die urheberrechtlichen Verwertungsrechte daran (noch) hat. Es kann ferner dahinstehen, ob der Beklagte sein Ölgemälde "The Unknowable" … in Deutschland selbst oder durch Dritte vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zur Schau gestellt oder öffentlich zugänglich gemacht hat oder ob dafür eine Erstbegehungsgefahr besteht. Dies alles kann zu Gunsten des Klägers hier unterstellt werden …" Zudem konnte das LG Berlin in Eders Gemälde mangels "hinreichenden Abstands" keine freie Bearbeitung i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG erkennen: "Nach § 23 Abs. 1 UrhG in der hier maßgeblichen Fassung vom 7.6.2021 dürfen Bearbeitungen und andere Umgestaltungen eines Werkes nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden. Wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung vor mit der Folge, dass die Verwendung des vorbestehenden Werkes erlaubnisfrei möglich ist. Maßgeblich für die Beurteilung des hinreichenden Abstands ist dabei nach der Gesetzesbegründung, inwieweit auch nach der Bearbeitung oder Umgestaltung noch ein Ausdruck der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers des vorbestehenden Werkes erkennbar ist. Es kann, wie nach bislang geltender Rechtslage unter § 24 UrhG a.F., auch dann von einem hinreichenden Abstand ausgegangen werden, wenn die aus dem benutzten Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge dem Gesamteindruck nach gegenüber der Eigenart des neuen Werkes so stark verblassen, dass das vorbestehende Werk nicht mehr oder nur noch rudimentär zu erkennen ist (sogenannter „äußerer Abstand", vergleiche BGH – I ZR 264/91 -, Urteil vom 11.3.1993, – Asterix-Persiflagen). In der Regel ist ein Verblassen anzunehmen, wenn die dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge im neuen Werk zurücktreten, so dass die Benutzung des älteren Werkes durch das neuer nur noch als Anregung zu einem neuen, selbständigen Werkschaffen erscheint (BGH – I ZR 9/15 -, Urteil vom 28.7.2016 – auf fett getrimmt). Demgegenüber greifen andere Bearbeitungen und Umgestaltungen, für die wie etwa bei der Parodie vor Aufhebung des § 24 UrhG a.F. noch ein „innerer Abstand" (vergleiche hierzu BGH – I ZR 263/91 -, Urteil vom 11. März 1993, – Alcolix) zum vorbestehenden Werk angenommen wurde, in der Regel in den Schutzbereich des Urheberrechts nach § 23 UrhG n.F. ein. Diese Fälle sind weitestgehend durch den neu geschaffenen § 51 a UrhG erfasst, der Nutzungen für die Zwecke der Karikatur, der Parodie und des Pastiches gesetzlich erlaubt (Gesetzesbegründung, Bundestags-Drucksache 19/27426, S. 78). Schließlich besagt der Referentenentwurf, dass die erkennbare Übernahme einer Melodie in der Regel eine Bearbeitung im Sinne des § 23 Abs. 1 UrhG n.F. ist, deren Verwertung der Zustimmung des Urhebers bedarf, weil der erforderliche Abstand nicht gewahrt werde, wenn eine bestehende Melodie in erkennbarer Weise einem neuen Werk zugrunde gelegt wird (vgl. Anlage B 61, S. 83). Das Bild des Beklagten wahrt keinen im Sinne des § 23 Abs. 1 UrhG hinreichenden äußeren Abstand zum Bild 1. Der Ausdruck der eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers des Bildes 1 bleibt darin erkennbar. Bild 1 wird als ein Teil des auch aus bestehenden Motiven komponierten Bildes 2 erkennbar wiedergegeben. Es dient als ein schon existierendes Werk aus einem Genre, dass der Beklagte als kitschig und hässlich bezeichnet, als weitgehend werkgetreu übertragener Hintergrund und wesentlicher Bestandteil des neuen Bildes. Der Beklagte bezweckte gerade, dass der Betrachter in seinem Bild bekannte, schon bestehende Motive wiederfindet und in einem neu geschaffenen bildlichen Zusammenhang wahrnimmt. Das Ausmaß der Ähnlichkeit und der – zwischen den Parteien unstreitigen – Wiedererkennbarkeit ist erheblich. Das Bild 1 geht nicht etwa als Hintergrund in einem als bildliche Einheit wahrgenommenen Werk auf und tritt darin zurück. Vielmehr ist Bild 2 eine collageartige Zusammensetzung verschiedener Bildelemente, die nach Inhalt, Maßstäben und Darstellung so in der Natur nicht zu sehen wären. Der Vogel ist überdimensional groß. Im Bereich der Beine der Frau ist ein anderer, grüner Hintergrund zu sehen, der links durch eine scharfe Schnittkante ohne bildlichen Zusammenhang den Vordergrund (Holzbalken mit Person) wie aufgeklebt wirken lässt. Auch die unterschiedliche Detaillierung durch den Beklagten, der Elemente wie den Menschen sehr fein detailliert, den Hintergrund dagegen eher verschwommener gemalt hat, unterstreicht die collageartige Zusammenstellung verschiedener Bildelemente zu einem Gesamtbild. Das Bild 1 bleibt daher im Bild 2 deutlich erkennbar. Es kommt dabei hier nicht darauf an, ob der Betrachter dem neuen Bild durch die Hinzufügungen eine andere Aussage als dem alten Bild entnimmt. Dies führte nicht dazu, dass das Bild 1 verblasst, sondern das Bild 2 beinhaltete trotz einer neuen Bildaussage eine Bearbeitung des benutzten Bildes 1, dessen wiedererkennbare Übernahme gerade beabsichtigt war. Ein Verblassen ist daher nicht festzustellen." Letztlich war dies nicht entscheidend, weil das LG Berlin in dem Gemälde Eders eine Pastiche i.S.v. § 51a UrhG n.F. erkannte, die erlaubnis- und vergütungsfrei zulässig ist: "Im vorliegenden Fall greift die Ausnahme des § 51 a UrhG zu Gunsten des Beklagten ein. Nach § 51 a UrhG ist die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zwecke der Karikatur, der Parodie und des Pastiches zulässig; diese Befugnis umfasst die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des genutzten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist. Nach der Gesetzesbegründung ist den anlehnenden Nutzungen nach § 51 a UrhG gemein, dass sie an ein oder mehrere vorbestehende Werke erinnern. In Abgrenzung zum unzulässigen Plagiat müssen sie zugleich wahrnehmbare Unterschiede zum Originalwerk aufweisen. Ein Verblassen des Originalwerkes ist nach der Gesetzesbegründung hier aber nicht erforderlich. Die Nutzung des vorbestehenden Werkes muss nach der Gesetzesbegründung einer inhaltlichen oder künstlerischen Auseinandersetzung des Nutzers mit dem Werk oder einem anderen Bezugsgegenstand dienen. Diese Auseinandersetzung ist nach Ansicht des Gesetzgebers Ausdruck der Grundrechte desjenigen, der die Karikatur, die Parodie oder den Pastiche anfertigt, und somit die Rechtfertigung für die Beschränkung des Urheberrechts am vorbestehenden Werk. Insbesondere sind hierbei die Meinungsfreiheit nach Artikel 11 Absatz 1 GRCh, die Pressefreiheit nach Artikel 11 Absatz 2 GRCh oder die Kunstfreiheit nach Artikel 13 GRCh zur Entfaltung zu bringen. Im konkreten Fall ist stets ein angemessener Ausgleich zwischen den Rechten und Interessen des betroffenen Rechtsinhabers und denen des Nutzers zu gewährleisten, wobei sämtliche Umstände des Einzelfalls wie etwa der Umfang der Nutzung in Anbetracht ihres Zwecks zu berücksichtigen sind. Zum Pastiche lautet die Gesetzesbegründung (a.a.O., Seite 91): „In der Literaturwissenschaft und der Kunstgeschichte wurde der (französische) Begriff des Pastiche ursprünglich verwendet, um eine stilistische Nachahmung zu bezeichnen, also zum Beispiel das Schreiben oder Malen im Stil eines berühmten Vorbilds. Hierbei geht es meist weniger um die Nutzung konkreter Werke als um die Imitation des Stils eines bestimmten Künstlers, eines Genres oder einer Epoche. In der Musik ist der (italienische) Begriff des Pasticcio für anlehnende Nutzungen dieser Art gebräuchlich. Allerdings ist der Stil als solcher urheberrechtlich nicht geschützt. Insofern bedarf es keiner Schranke des Urheberrechts. Deshalb erlaubt der Pastiche im Kontext des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe k InfoSoc-RL über die Imitation des Stils hinaus grundsätzlich auch die urheberrechtlich relevante Übernahme fremder Werke oder Werkteile. Der Pastiche muss eine Auseinandersetzung mit dem vorbestehenden Werk oder einem sonstigen Bezugsgegenstand erkennen lassen. Anders als bei Parodie und Karikatur, die eine humoristische oder verspottende Komponente erfordern, kann diese beim Pastiche auch einen Ausdruck der Wertschätzung oder Ehrerbietung für das Original enthalten, etwa als Hommage. Demnach gestattet insbesondere der Pastiche, nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 UrhDaG-E bestimmte nutzergenerierte Inhalte (UGC) gesetzlich zu erlauben, die nicht als Parodie oder Karikatur zu klassifizieren sind, und bei denen im Rahmen der Abwägung von Rechten und Interessen der Urheber und der Nutzer ein angemessener Ausgleich gewahrt bleibt. Zitierende, imitierende und anlehnende Kulturtechniken sind ein prägendes Element der Intertextualität und des zeitgemäßen kulturellen Schaffens und der Kommunikation im „Social Web". Hierbei ist insbesondere an Praktiken wie Remix, Meme, GIF, Mashup, Fan Art, Fan Fiction oder Sampling zu denken. Das Unionsrecht begründet die Pflicht zur Einführung der nun in § 51 a UrhG-E verankerten Erlaubnisse in Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2 DSM-RL und ErwG 70 DSM-RL ausdrücklich mit dem Schutz der Meinungs- und Kunstfreiheit. Die gesetzlichen Erlaubnisse müssen stets mit Blick auf die neuen elektronischen Medien gelesen werden (vergleiche bereits ErwG 31 Satz 2 InfoSoc-RL). Bei ihrer Auslegung sollten die Besonderheiten des jeweiligen analogen und digitalen Umfelds sowie der technologische Fortschritt berücksichtigt werden." Bei dem Pastiche geht es demnach um einen kommunikativen Akt der stilistischen Nachahmung, wobei auch die Übernahme fremder Werke oder Werkteile erlaubt ist. Der Pastiche setzt eine bewertende Referenz auf ein Original voraus (KG – 24 U 66/19 -, Urteil vom 30.10.2019; Pötzlberger, GRUR 2018, 675, 679). Das ältere Werk muss in Abgrenzung zum unzulässigen Plagiat so benutzt werden, dass es in einer veränderten Form erscheint. Dazu reicht es aus, dem Werk andere Elemente hinzuzufügen oder das Werk in eine neue Gestaltung zu integrieren, vgl. § 62 Abs. 4a UrhG. Da die Schranke der Meinungs- und Kunstfreiheit dient, ist ein Mindestmaß eigener Kreativität des Begünstigten erforderlich, ohne dass dabei die für eine Urheberrechtsschutzfähigkeit erforderliche Schöpfungshöhe erreicht werden muss (Hofmann, GRUR 2021, 895, 898; Spindler, WRP 2021, 1111, 1116, jeweils m.w.N.). Für die Beurteilung ist ein objektiver Maßstab von jemanden anzulegen, dem das vorbestehende Werk bekannt ist und der für die Wahrnehmung der kommunikativen bzw. künstlerischen Auseinandersetzung das erforderliche intellektuelle Verständnis besitzt (BGH – I ZR 9/15 -, Urteil vom 28.7.2016 – auf fett getrimmt, m.w.N.; vgl. KG – 24 U 66/19 -, Urteil vom 30.10.2019: „informierter Betrachter"). Das Bild 2 ist nach Ansicht der Kammer als Pastiche zu qualifizieren. Der Beklagte hat Bild 1 durch eine weitgehende Übernahme stilistisch nachgeahmt. Wer das Bild 1 oder sein Genre kennt, erkennt dieses in Bild 2 als Hintergrund wieder. Es ist davon auszugehen, dass das Bild 1 eine gewisse Bekanntheit jedenfalls dadurch erreicht hat, dass es – egal von wem – im Internet auf gängigen Handelsplattformen jedermann in vielfältiger Form als dekorativer Konsumartikel angeboten wird, was wiederum impliziert, dass die Anbieter gerade in diesem Motiv gute Vermarktungschancen sehen. Unstreitig handelt es sich bei dem Bild jedenfalls um ein typisches Beispiel des entsprechenden Genres. Der Äußerung des Beklagten, er habe in dem Bild 1 ein typisches Kitschbild, wie es dutzendfach im Internet zu finden sei, gesehen, ist der Kläger inhaltlich nicht erheblich entgegengetreten. Ebenso wie der Gesetzgeber zitierende, imitierende und anlehnende Kulturtechniken als ein prägendes Element der Intertextualität und des zeitgemäßen kulturellen Schaffens in der digitalen Welt anerkennt, ist eine künstlerische Auseinandersetzung in umgekehrter Richtung anzuerkennen, indem etwa wie hier ein digitales Werk, dessen Original eine auf einem Monitor aufrufbare Datei ist, von des Künstlers Hand mit Pinsel und Ölfarbe auf eine Leinwand übertragen wird, um durch die Übertragung eines Computerbildes auf ein klassisches Medium der Bildkunst ein gegenständliches Unikat zu schaffen. Der Wechsel des Mediums alleine lässt zwar in der Regel noch keine über ein Plagiat hinausgehende Befassung mit der Vorlage erkennen, solange weiter dasselbe Motiv einziger Gegenstand der Darstellung bleibt. Im vorliegenden Fall wurde das Bild 1 aber nicht als bloße Kopie, sondern als Hintergrund für ein neues Bild auf die Leinwand übertragen. Bild 1 erschöpft sich in einer eindimensionalen Landschaftsdarstellung ohne eine erkennbare darüber hinausgehende Aussage. Eine so reduzierte Betrachtung verbietet sich bei dem Bild 2. Das Bild 2 wird geprägt von einem hölzernen Balkongebälk, das das Bild als Kreuz belegt und von der daran lehnenden alten nackten Frau, die mit derselben Blickrichtung wie der Bildbetrachter auf den Hintergrund schaut. Erkennbar wird in dem Bild eine menschliche Betrachtung thematisiert, wobei dem Bildbetrachter eine eigene Auseinandersetzung mit der im Bild dargestellten Betrachtungssituation angeboten wird, indem er – wie der Vogel – auf die alte Frau schaut und sich – ohnehin schon in derselben Blickrichtung befindend – in sie hineinzuversetzen versucht. Dass dabei das Bild 1 nicht als einfacher Bildhintergrund kopiert wurde, sondern in einen neuen inhaltlichen Zusammenhang gestellt wurde, wird für jemanden, der sich mit einer Offenheit für Kunst das Bild 2 in Ruhe betrachtet, durch verschiedene künstlerische Elemente erkennbar. Dabei ist von einer Betrachtung des Originals auszugehen, wie sie der Kammer durch eine im Gerichtssaal präsentierte Kopie des Bildes 2 in Originalgröße so gut wie ohne das Original machbar ermöglicht worden ist. Danach ist festzustellen, dass das Bild 1 als Hintergrund in einer gröberen, weniger scharfen Form in das Bild 2 übertragen wurde, in dem der Vordergrund (Körper, Holz) mit einer deutlich größeren, fotorealistischen Schärfe und Detailgenauigkeit kontrastiert. Soweit der Kläger dem entgegenhält, dass auch sein Bild bei einer entsprechenden Vergrößerung gröber aussehe, so handelte es sich zum einen nicht um die typische Betrachtungsweise und würde zum anderen das gesamte Bild eine einheitlich gröbere Auflösung haben, während das Bild des Beklagten auch durch die verschiedenen Detailgrade wirkt. Dazu erkennt der Betrachter des Bildes 2 die collageartige Zusammensetzung aus mehreren Bildelementen verschiedener Stilrichtungen an der in die linke obere Ecke eingefügte Ruine eines sakralen Bauwerks im Stil der Romantik, wie sie von Caspar David Friedrich bekannt sind, ohne dass dessen Standort zu einem einsamen Lavahang passt. Hinzu kommt der in die untere rechte Ecke eingefügte Vogel, der zur alten Frau schaut und in seiner überdimensionalen Größe (ein sperlingsartiger Singvogel, der der Frau bis zum Knie geht und die Breite der Frau erreicht) als bewusste Hinzufügung erscheint. Schließlich wird der Collagecharakter des Bildes 2 dadurch verstärkt, dass der Korbstuhl und die untere Verkleidung des Balkons mit scharfen Kanten unzusammenhängend in den Lavahintergrund übergehen, als seien zwei verschiedene Bilder zugeschnitten und zusammengefügt worden. Während hinter der durchbrochenen Balkonverkleidung grünes Laub durchschimmert, wütet direkt links daneben Lava auf einem dunklen Berghang, ohne dass diese Perspektiven in der Realität miteinander vereinbar wären. Selbst wenn man annimmt, dass dem maßgeblichen Betrachter der Vogel nur als solcher und nicht als ein mystischer Todesbote erscheint, verstärkt dessen Blick auf die Frau, die wiederum mit gesenktem Kopf nach außen schaut, die Betrachtungsperspektive, in der das Bild 1 nur als ein erkennbar eingefügter Hintergrund als Teil einer Collage verschiedener Bildelemente erscheint. Der referierende, bewertende Bezug zum Bild 1 ist darin zu sehen, dass ein typisches Kitschbild, das dem Konsumenten etwas Schönes, Attraktives bieten soll, zum Inhalt einer collageartigen Darstellung, die seine Betrachtung in einem anderen, kritischen Zusammenhang erzwingt, gemacht wird, wobei der Bildbetrachter sich in die Positionen einer älteren Person versetzt, die mit gesenktem Kopf und damit offenbar nachdenklich oder niedergeschlagen und nackt, also unverstellt und ungeschönt, auf ein Panorama blickt, bei dem das lebendige Grün im Vordergrund nahe dieser Person rundherum von einer düsteren, irreal wirkenden Szenerie verdrängt wird. Sei es als ein Rückblick auf das bisherige Leben oder als ein Ausblick auf das noch Kommende, wird das positiv Dekorative des Bildes 1 in Bezug genommen und in Frage gestellt. Dabei reicht es aus, dass der Beklagte das Bild 1 nur als ein Beispiel für sein Genre ausgewählt hat und eine Referenz zu diesem Genre herstellen wollte. Die inhaltliche Auseinandersetzung des Beklagten mit dem Bild 1 bzw. dem dadurch repräsentierten Genre kitschig-dekorativer Landschaftsmotive geschieht antithematisch. Der Kläger sieht das Bild 1 als Ausdruck der Hoffnung, der Erschaffung von neuem Land und neuem Leben sowie als Bild der Wiedergeburt. Jedenfalls wird dem Bild 1 eine positive, dekorative Wirkung zugeschrieben, anderenfalls es nicht zu erklären wäre, dass gerade dieses Bild von Dritten als vielfältige Dekoration im privaten Lebens- und Konsumbereich angeboten wird, wobei das Motiv auf einem Teppich, als Wandbild oder als Türbeschichtung das persönliche Lebensumfeld dauerhaft und präsent prägt, also in der Regel eine positive Wirkung entfalten und dem Wohlfühlen dienen soll. Diese Wirkung wird im Bild 2 umgekehrt. Das Blattgrün, wie es im nahen Umfeld der Frau noch jenseits der Balkonbrüstung scheint, wird von einer dramatischen Lavalandschaft umgeben und verdrängt. Links unten kommen neben dem Grün tote Äste ins Bild, oben links erscheint deplaziert ein kirchenartiges Gewölbe. Die Bildeinteilung wird durch das massive Holzkreuz des Balkongeländers geprägt, wobei Ähnlichkeiten mit einem Grabkreuz nicht fern liegen. Auf dieses Kreuz gestützt, lässt die kraftlose Haltung und der hängende Kopf der Frau Resignation erkennen. Die Betrachtung eines Hintergrundes, dessen kitschige Illusion für sich betrachtet vielen attraktiv erscheinen mag, entfaltet dort offenbar keine positive Wirkung mehr. Mit Begriffen wie Hoffnung, neues Leben oder Wiedergeburt ist das Bild 2 nicht in Verbindung zu bringen. In der neuen, gegensätzlichen Betrachtung der Landschaft liegt eine, kritische antithematische Befassung mit dem Bild 1, das als negativ wahrgenommener Dekorationskitsch präsentiert und damit in Frage gestellt wird. Dass das Bild 1 dabei nicht nur ein vom Beklagten geschaffenes Hintergrundmotiv ist, sondern eines der vorgefundenen Elemente, die in dem Bild collageartig zu einem neuen Ganzen zusammengefügt wurden, wird aus der Malweise mit unterschiedlicher Detaillierung, scharfen, unzusammenhängenden Bildübergängen und der Zusammenstellung verschiedener nach Thema, Standort und Maßstab nicht zusammen passender Elemente (Kapelle, Vogel) sowie durch die deutliche Naht, die rechts von der Balkonstütze senkrecht durch das Bild verläuft und den Eindruck eines collageartig „zusammengeklebten" Werkes verstärkt, indem der Hintergrund wie aus mehreren Teilen bestehend zusammenmontiert wirkt." Auch die Interessenabwägung, ob die Freistellung des Pastiche durch die Schranke des § 51 a UrhG im konkreten Fall einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Eigentumsrecht und sonstigen schützenswerten Interessen des Urhebers des "Scorched Earth" auf der einen Seite und der Kunst- und Meinungsfreiheit des Beklagten, des Malers Martin Eder, auf der anderen Seite gewährleistet, geht nach Ansicht des LG Berlin zu Gunsten des Beklagten aus: "Der Beklagte hat das Bild 1 als Vorlage eines Bestandteils seines Werkes genommen. Er hat sich dabei nicht einfach die Mühe erspart, einen eigenen Hintergrund passenden Aussehens zu schaffen. Es ging dem Beklagten vielmehr gezielt darum, als Hintergrund etwas bereits Vorhandenes zu übernehmen und zum erkennbar fremden Bestandteil eines neuen Werkes zu machen. Das bedingt gerade eine weitgehend werkgetreue, erkennbare Übernahme des Bildes 1. Auch wenn es aus Sicht der Kammer nicht darauf ankommt, dass eine bestimmte künstlerische Arbeitsweise bereits etabliert ist, sondern auch schon der erste Ausdruck einer neuen künstlerischen Arbeitsweise der Kunstfreiheit unterliegt, bekräftigt die bisherige Ausdrucksweise des Beklagten, vorhandene Darstellungen aller Art und verschiedener Stile zu einem neuen Werk zusammen zu fügen und damit in einen neuen Zusammenhang zu stellen, seine künstlerische Aussage im Bild 2. Dies ist über den Grundsatz, dass kein Künstler in einer Art Vakuum bei Null anfängt, sondern in einer Welt kultureller Geschichte wirkt und daher zwangsläufig mehr oder weniger auf Vorhandenem aufbaut (vgl. Schack, GRUR 2021, 904, 906), hinausgehend die Haltung eines Künstlers, gezielt vorhandene Elemente verschiedener Stilrichtung erkennbar als Material und Motiv des eigenen Bildschaffens zu übernehmen und damit bewusst schon Geschaffenes neu zu verarbeiten. Dies haben verschiedene Kunsthistoriker, die sich bereits vor der Schaffung des Bildes 2 mit der Arbeit des Beklagten befasst haben, festgestellt. Nach der Kunsthistorikerin Dr. Bettina R2. ist der Zugang des Beklagten zur Malerei konzeptueller Natur, wobei sich sein Werk aus vielen Quellen von kunsthistorischen Vorlagen bis zur täglichen Bilderflut im Internet speist (Anlage B 41, 2017). Die Kunsthistorikerin Leonie P. sieht es als Bestandteil der Arbeit des Beklagten an, ein Grauen in eine schöne Oberfläche, in Stereotypen und Symbolbilder, die eigentlich etwas ganz anderes meinen, zu verpacken (Anlage B 42, 2017). Die Kunsthistorikerin Stefanie M. sieht den Beklagten aus dem unendlichen Bildfundus der Kunst, der Historie und der Werbung schöpfen, um diesen mit Utopien und eigenen Imaginationen zu mischen (Anlage B 44, 2009). Die Übernahme vorgefundener Motive des Kitsches oder des Trashs kann durchaus als stilprägend für das Werk des Beklagten angesehen werden (KG – 24 U 66/19 -, Urteil vom 30.10.2019). Was der Gesetzgeber mit dem Pastiche im Sinne des § 51 a UrhG als zeitgemäßes kulturelles Schaffen und Kommunikation im sogenannten Social Web ermöglichen will, wobei er insbesondere an Praktiken wie Remix, Meme, GIF, Mashup, Fan Art, Fan Fiction oder Sampling gedacht hat, muss auch für eine künstlerische Ausdrucksweise in „umgekehrter" Richtung, digitale Bilddateien, die auf einem digitalen, weltweiten Internetmarkt kommerziell verwertet werden, in ein klassisches Ölgemälde zu übertragen und dort in einem eigenen inhaltlichen, schöpferischen Sinne wiedererkennbar zu präsentieren, gelten. Die größere schöpferische Leistung und der größere Abstand, ein Digitalbild nicht im copy-and-paste- Verfahren zur Grundlage eines eigenen Digitalbildes zu machen, in das digital noch einige weitere Elemente eingefügt werden, um dieses dann als neues elektronisches Medium zu vermarkten, sondern es stattdessen von Hand mit Ölfarben und Pinsel auf eine Leinwand zu übertragen, um ein analoges Unikat zu schaffen, spricht aus Sicht der Kammer gerade nicht gegen die Anwendung des § 51 a UrhG auf ein Ölgemälde. Der Beklagte stellt einen erheblichen Abstand zwischen den Werken her, indem er ein ganz anderes Medium wählt. Während Bild 1 eine am Computer erzeugte Bilddatei ist, die an einem Computermonitor sichtbar gemacht wird und daher auf die Wiedergabegröße des jeweiligen Monitors (in der Praxis typischerweise vom Mobiltelefon bis zum Laptop) beschränkt ist, wobei die Farbwirkung zweidimensional (Bildschirmoberfläche) durch die gleichmäßige Hinterleuchtung des Monitors entsteht, ist das Bild 2 ein großformatiges, mit dem Pinsel und Ölfarben auf eine Leinwand gemaltes Unikat, dessen Farbwirkung gewissermaßen dreidimensional (Farbschichtenauftrag mittels Pinsel) durch die individuelle Beleuchtung von außen entsteht. Wer das Originalwerk des Beklagten in seiner durch das Leinwandformat vorgegebenen festen Größe sehen will, ist auf eine Ausstellung des Bildes angewiesen. Er sieht sich dann nicht irgendeinem flüchtigen Monitorbild, sondern einem großformatigen Ölbild gegenüber, was naturgemäß einen ganz anderen optischen Eindruck erzeugt. Der Beklagte verfolgt mit dem Bild 2 keine Vermarktungsabsichten. Er sieht das Bild als ein Unikat an. Dieses hat er bei kostenfreiem Zutritt ausstellen lassen und dann einem befreundeten Sammler überlassen. Dass er dafür Geld bekommen hat, ist nicht ersichtlich. Der Beklagte hat dabei das Bild 1 so übernommen, dass sein Bild 2 nicht damit verwechselt wird, sondern nur daran erinnert, indem der Betrachter den Hintergrund als ein collageartig eingefügtes Motiv erkennt. Eine Entstellung des Bildes 1 ist damit nicht verbunden. Der Beklagte verwendet den Stil des Bildes 1 als Bestandteil seiner eigenen künstlerischen Aussage, wobei es eine Geschmacksfrage des jeweiligen Betrachters ist, ob er das Bild 1 oder dessen Stil positiv oder negativ bewertet. Auf der anderen Seite wird der Kläger in seinen Möglichkeiten, das Bild 1 primär und sekundär zu verwerten, durch das Bild 2 nicht eingeschränkt. Das Bild 2 wird nicht als Reproduktion oder als Dekoration für irgendwelche Produkte verwertet. Soweit es vervielfältigt wurde, geschah dies nur im erkennbaren Zusammenhang mit der Ausstellung dieses Bildes oder mit dem künstlerischen Schaffen des Beklagten, wobei es hier ohnehin nur auf dem Beklagten zuzurechnende Verwertungshandlungen in Deutschland ankommen kann. Dass dadurch die eigenen Verwertungsmöglichkeiten des Bildes 1 eingeschränkt werden, hat der Kläger nicht dargetan. Vielmehr sorgt der Kläger selbst dafür, dass das Bild 2 im Internet weiterhin abrufbar bleibt, indem er dieses an hervorgehobener Stelle seines Internetauftritts präsentiert, während der Beklagte sein Bild 2 nicht mehr im Internet abrufbar macht. Auch wenn dem Urheber des Bildes 1 nicht jede nur denkbare wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit zugewiesen bleiben muss, ist hier kein konkreter Anhaltspunkt dafür erkennbar, dass der Kläger durch das Bild 2 in den wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten des Bildes 1 irgendwie eingeschränkt werden könnte. Der Kläger macht eine solche Einschränkung auch nicht geltend. Eine solche wirtschaftliche Beeinträchtigung liegt viel mehr in der umfassenden kommerziellen Verwertung des Bildes 1 durch Dritte für alle möglichen Dekorations- und Konsumartikel auf Online- Verkaufsplattformen, die nach dem Vortrag des Klägers ohne sein Einverständnis und ohne sein Zutun, mithin unter Verletzung seiner (hier unterstellten) Urheberrechte stattfindet, ohne dass dem Klägervortrag ein ernsthaftes und nachhaltiges Bemühen um eine Unterlassung, ggfs. durch entsprechende Ansprache der Plattformbetreiber, zu entnehmen ist. Da auch hier auf das Klagebegehren abzustellen ist, nach deutschem Recht vor bestimmten Verwertungshandlungen geschützt zu werden und danach aus Sicht der Kammer allenfalls auf eine Wiederholungsgefahr hinsichtlich des öffentlich Zugänglichmachens des Bildes 2 durch den Beklagten im Internet abzustellen ist, bleibt dem Kläger im Rahmen dieser Abwägung vorzuhalten, dass er selbst erheblich zur Abrufbarkeit des Bildes 2 im Internet beiträgt, indem er es fortdauernd an prominenter Stelle in seinem eigenen Intemetauftritt präsentiert, während der Beklagte das Bild aus seinem Intemetauftritt längst entfernt hat. Das Eingreifen der Schranke des Pastiches setzt nicht voraus, dass in/an dem Werk (oder anderweitig) die Schöpfer übernommener Werke benannt werden. Zum Streitgegenstand gemacht hat der Kläger seine Benennung nicht. Die Schranke bedingt auch nicht, sich zuvor von dem Urheber des übernommenen Werkes Nutzungsrechte einräumen zu lassen, etwa gegen eine Lizenzzahlung. Soweit eine Übernahme fremder Werke oder Werkteile nach § 51 a UrhG erlaubt ist, muss der Urheber des übernommenen Werkes dies ohne Weiteres hinnehmen, weil seine Urheberrechte dadurch gerade nicht verletzt werden. Wer ein Werk schafft und veröffentlicht, setzt es damit auch einer eigenmächtigen Auseinandersetzung in den Schranken des § 51 a UrhG aus. Sein Urheberrecht ist von vomeherein nur in den gesetzlichen Schranken gewährt, wird also durch eine Wahrnehmung der Schrankenbefugnisse nicht verletzt. Das Interesse des Beklagten, seine Meinung in der künstlerischen Gestalt collageartiger, referenzierender Übernahmen von vorhandenem Bildmaterial aller Art auszudrücken und dabei den für ihn nach eigener Darstellung und der Darstellung von Kunsthistorikern prägenden künstlerischen Stil zu pflegen, überwiegt das Interesse des Klägers an der Wahrung seines Eigentums und seines Urheberrechts nach Vorstehendem deutlich."
Mit Beschluss vom 27. Januar 2022, Az. I ZR 84/21 (n.v.) hat der Bundesgerichtshof BGH die Nichtzulassungsbeschwerde des Bundesinstituts für Risikobewertung gegen das Urteil des OLG Köln vom 12. Mai 2021, Az. 6 U 146/20 ohne nähere Begründung zurückgewiesen; das Urteil des OLG Köln ist damit rechtskräftig.
Das OLG Köln hat in seinem Urteil vom 12. Mai 2021 festgestellt, dass die Veröffentlichung der Zusammenfassung des sog. Glyphosat-Gutachtens zu den Krebsrisiken aus dem Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat durch die Berliner Transparenz-Initiative FragDenStaat rechtmäßig war und keine Urheberrechte des Bundesinstituts für Risikobewertung verletzt hat. Wie schon hinsichtlich der sog. Afghanistanpapiere stellen sich der BGH auch mit dieser Entscheidung gegen den zweckfremden Einsatz des Urheberrechts als Mittel der Zensur ("Zensurheberrecht").
Mit seinem "Influencer III"-Urteil vom 13. Januar 2022 (Az. I ZR 35/21) hat der BGH seine Rechtsprechung zum Influencer-Marketing weiterentwickelt und festgestellt, dass es sich bei der Werbung für Produkte oder Dienstleistungen Dritter durch eine Bloggerin dann um kommerzielle Kommunikation (Werbung) im Sinn von § 2 Satz 1 Nr. 5, 5b TMG, § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV / § 2 Abs. 2 Nr. 7 MStV handelt, wenn die Bloggerin für die Bewerbung der Produkte oder Dienstleistungen eine Gegenleistung erhält; insoweit ist es ausreichend, wenn sie die Produkte (im Fall: Ohrringe) von dem Hersteller geschenkt bekommt. Beiträge von Influencer_innen, in sozialen Medien wie z.B Instagram sind demnach immer dann als Werbung kenntlich zu machen, wenn der_die Influencer_in für deren Präsentation eine ggf. auch nur geringwertige Gegenleistung erhält. Wird der kommerziellen Charakter der Produktpräsentation nicht offengelegt, ist dies auch "unlauter" i.S.v. § 5a Abs. 6 UWG. ... mehr Erneut hat der BGH zudem festgestellt, dass bereits der Betrieb eines Instagram-Profils durch eine_n Influencer_in grundsätzlich eine geschäftliche Handlung i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist, weil er_sie dadurch ihre Bekanntheit und ihren Werbewert steigert. Die Präsentation der von dem_der Influencer_in selbst gekauften Kleidung ist aber keine Werbung i.S.d. Spezialsvorschriften § 2 Satz 1 Nr. 5, 5b TMG, § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV / § 2 Abs. 2 Nr. 7 MStV und musste im Fall des BGH daher (anders als die Präsentation der geschenkten Ohrringe) auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden; es liegt dann auch kein Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG (Irreführung durch Unterlassen des Hinweise auf den werblichen Charakter des Beitrags) vor. Mit Urteil vom 9. September 2021, Az. I ZR 90/20 – Influencer I hatte der BGH festgestellt, dass Instagram-Beiträge von Influencer_innen grundsätzlich als geschäftliche Handlungen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG zugunsten des eigene Unternehmens anzusehen sind, weil er_sie dadurch seine_ihre Bekanntheit und ihren Werbewert steigert. Die Präsentation von Produkten oder Dienstleistungen Dritter in einem Social-Media-Profil sind zudem als geschäftliche Handlungen zugunsten dieser anderen Unternehmen anzusehen, wenn die Präsentation nach ihrem "Gesamteindruck übertrieben werblich" ausfällt: "Influencer, die mittels eines sozialen Mediums wie Instagram Waren vertreiben, Dienstleistungen anbieten oder das eigene Image vermarkten, betreiben ein Unternehmen. Die Veröffentlichung von Beiträgen dieser Influencer in dem sozialen Medium ist geeignet, ihre Bekanntheit und ihren Werbewert zu steigern und damit ihr eigenes Unternehmen zu fördern. Eine geschäftliche Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens stellt die Veröffentlichung eines Beitrags – abgesehen von dem hier vorliegenden Fall, dass die Influencerin dafür eine Gegenleistung erhält – allerdings nur dar, wenn dieser Beitrag nach seinem Gesamteindruck übertrieben werblich ist, etwa weil er ohne jede kritische Distanz allein die Vorzüge eines Produkts dieses Unternehmens in einer Weise lobend hervorhebt, dass die Darstellung den Rahmen einer sachlich veranlassten Information verlässt." Dazu hat der BGH fesgestellt, dass sog. Tap Tags auf den dargestellten Produkten, die Darstellung noch nicht zur Werbung machen, anders als eine Verlinkung auf die Internetseite des Herstellers: "Allein der Umstand, dass Bilder, auf denen das Produkt abgebildet ist, mit "Tap Tags" versehen sind, reicht für die Annahme eines solchen werblichen Überschusses nicht aus. Bei einer Verlinkung auf eine Internetseite des Herstellers des abgebildeten Produkts liegt dagegen regelmäßig ein werblicher Überschuss vor. Die Prüfung, ob ein Beitrag übertrieben werblich ist, bedarf der umfassenden Würdigung durch das Tatgericht, an der es im Streitfall hinsichtlich der weiteren Beiträge, für deren Veröffentlichung eine Gegenleistung nicht festgestellt ist, fehlt." Die Präsentation von Produkten oder Dienstleistungen Dritter sind zudem dann als geschäftliche Handlungen zugunsten Dritter anzusehen, wenn der_die Influencer_in für die Präsentation (dort der Marmelade "Raspberry Jam") eine Gegenleistung erhält auch dann liegt ein Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG (Irreführung durch Unterlassen des Hinweise auf den werblichen Charakter des Beitrags) und gegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG sowie § 58 Abs. 1 Satz 1 RStV bzw. § 22 Abs. 1 Satz 1 MStV (Pflicht zur Kennzeichnung von Werbung) vor: "Der die "Raspberry Jam" betreffende Beitrag, für den die Beklagte eine Gegenleistung des Herstellers erhalten hat, verstößt gegen § 5a Abs. 6 UWG, weil der kommerzielle Zweck dieses Beitrags, den Absatz von Produkten dieses Herstellers zu fördern, nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Oberlandesgerichts nicht hinreichend kenntlich gemacht ist und sich auch nicht aus den Umständen ergibt. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die Verbraucher erkennen, dass die Beklagte mit der Veröffentlichung von Beiträgen auf ihrem Instagram-Profil zugunsten ihres eigenen Unternehmens handelt. Für die Verbraucher muss gerade der Zweck eines Beitrags, ein fremdes Unternehmen zu fördern, erkennbar sein. Das Nichtkenntlichmachen des kommerziellen Zwecks eines solchen mit "Tap Tags" und Verlinkungen versehenen Beitrags ist regelmäßig geeignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung – dem Anklicken des auf das Instagram-Profil des Herstellers führenden Links – zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Darüber hinaus verstößt der Beitrag zur "Raspberry Jam" gegen § 3a UWG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG sowie § 58 Abs. 1 Satz 1 RStV bzw. § 22 Abs. 1 Satz 1 MStV, weil die darin liegende kommerzielle Kommunikation bzw. Werbung nicht klar als solche zu erkennen ist." Mit weiteren Urteilen vom 9. September 2021 (I ZR 125/20 und I ZR 126/20 – Influencer II) hat der BGH ebenfalls festgestellt, dass Instagram-Beiträge einer Influencerin, für die sie keine Gegenleistung erhalten hat, zwar als geschäftliche Handlungen der Influencerin zugunsten des eigenen Unternehmens anzusehen sind (vgl. zuvor), aber dennoch nicht als Werbung kennzeichnungspflichtig sind (kein Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG), weil sich dieser kommerzielle Zweck – Erhöhung der eigene Bekanntheit und des eigenen Werbewerts – unmittelbar aus den Umständen ergibt. Hinsichtlich geschäftlicher Handlungen zugunsten anderer Unternehmen scheidet ein Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG dann aus, wenn der_die Influencer_in für die entsprechenden Beiträge keine Gegenleistung erhalten hat (und diese auch nicht übertrieben werblich ausfallen) und diese Beiträge daher nach den vorrangigen Spezialvorschriften des § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG, § 58 Abs. 1 Satz 1 RStV und § 22 Abs. 1 Satz 1 MStV nicht als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Ebenso liegt dann auch kein Verstoß gegen Nr. 11 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG (sog. Blacklist) vor.
Mit Urteil vom 19. Juni 2019 (Az. 9 O 3006/17, nrk) hat das Landgericht Braunschweig die Klage der Erbin eines als Konstrukteur an der Entwicklung des ersten VW Käfer beteiligten Angestellten auf Zahlung einer angemessenen Nachvergütung nach § 32a UrhG (sog. Fairness-Ausgleich) abgewiesen. ... mehr Wie schon hinsichtlich des Ur-Porsches hatte die Klägerin geltend gemacht, dass ihr Vater Erwin Franz Komenda, der ab 1931 bei Porsche gearbeitet hatte, der Schöpfer des Ur-Käfers im urheberrechtlichen Sinn sei und sich sein Werk (die äußere Form des Ur-Käfers) bis heute in dem moderten VW Beetle fortsetze. Wegen des großen Verkaufserfolgs des VW Käfers und VW Beetle stehe ihr daher eine weitere Vergütung nach § 32a UrhG (Fairness-Ausgleich) zu. Anders als das LG Stuttgart hins. des Ur-Porsches (Urt. v. 26. Juli 2018 (Az. 17 O 1324/17) hat das Landgericht (unter Beachtung der nach seiner Ansicht maßgeblichen damaligen strengen Prüfungsmaßstäbe für angewandte Kunst i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG, vor den Entscheidungen BGH – Seilzirkus und BGH – Geburtstagszug) die Urheberrechtsfähigkeit des Ur-Käfers als Werk der angewandten Kunst anhand von Zeichnungen verneint. Es hat dazu festgestellt, dass es zur Zeit der Anfertigung der Entwürfe bereits zahlreiche Konzepte von Fahrzeugen mit Heckmotor in stromlinienförmiger Karosse mit herabgezogener Fronthaube und dem in die herabgezogene Motorhaube übergehenden Heck gegeben habe, u.a. die Fahrzeugmodelle Tatra V570 und Mercedes Typ 130. Zudem hat das Landgericht Braunschweig einen übereinstimmenden Gesamteindruck des ab 2014 gebaute VW Beetle mit dem Ur-Käfer verneint und ist daher von eine sog. "freien Bearbeitung" i.S.v. § 24 UrhG a.F. (heute teilweise aufgegangen in § 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG) ausgegangen; aus dem Urteil: "Nach Auffassung der Kammer sind die Grundsätze der Geburtstagszug-Entscheidung nicht auf Schöpfungen vor dem Inkrafttreten des UrhG am 01.01.1966 anwendbar. … Danach ist es nach Auffassung der Kammer möglich § 32a UrhG auch auf Verträge/Schöpfungen vor 1966 anzuwenden, wenn die Verwertungshandlungen nach dem 28.03.2002 vorgenommen worden sind. Die Frage der Schutzfähigkeit eines Werkes der angewandten Kunst, welches vor dem Inkrafttreten des UrhG geschaffen wurde, beurteilt sich dagegen nach altem Recht. c) Es gelten für die Schutzfähigkeit damit folgende Maßstäbe, die vom RG entwickelt worden sind: aa) Es muss eine eigenpersönliche geistige Schöpfung vorliegen, die mit den Darstellungsmitteln der Kunst durch formgebende Tätigkeit hervorgebracht und vorzugsweise für die Anregung des ästhetischen Gefühls durch Anschauung bestimmt ist. Wenn es dabei auch auf den höheren oder geringeren Kunstwert an sich nicht ankommt, so ist doch zur Abgrenzung gegenüber dem Geschmacksmuster daran festzuhalten, dass bei Kunstwerken der ästhetische Gehalt einen solchen Grad erreichen muss, dass nach den im Leben herrschenden Anschauung noch von Kunst gesprochen werden kann. Es ist daher zu prüfen ob durch die Art und Weise der Ausführung eine eigenartige, zur Anregung des ästhetischen Gefühls geeignete Wirkung erzielt wird. Den Maßstab hierfür bildet der Gesamteindruck, der sich aus dem Zusammenwirken aller wesentlichen Eigenschaften ergibt. Für die Frage der Abgrenzung des Kunstwerks zum Geschmacksmusterschutz kommt es auf den Grad des Schönheitsgehalts an. Dieser muss beim Kunstwerk so groß sein, dass nach der im Leben herrschenden Anschauung noch von Kunst gesprochen werden kann. Die gegenüber dem Geschmacksmuster bestehende Grenze darf nicht zu niedrig angesetzt werden (RG in RGZ 155, 199). Dem folgte der BGH bis zur Geburtstagszug- Entscheidung: Das abgrenzende Kriterium zu dem bloßen Geschmacksmuster liegt somit in dem, von einem Kunstwerk zu fordernden, ästhetischen Überschuss, der sich aus der erkennbaren Gestaltung eines besonderen künstlerischen Formgedankens ergibt. Bei der Prüfung aber, ob der ästhetische Gehalt ausreicht, die Kunstwerkeigenschaft eines Erzeugnisses zu begründen, müssen strenge Anforderungen gestellt werden. Maßgebend ist allein, ob der ästhetische Gehalt als solcher ausreicht, nicht nur von einer geschmacklichen, sondern einer künstlerischen Leistung zu sprechen (vgl. BGH GRUR 1957, 291 – Europapost). bb) Bei Prüfung der Frage, ob der für ein Kunstwerk erforderliche Mindestgrad an ästhetischem Gehalt vorliegt, sind diejenigen Formungselemente nicht zu berücksichtigen, die auf bekannte Vorbilder zurückgehen, soweit nicht gerade in ihrer Kombination untereinander oder mit einem neuen Element eine für einen Kunstschutz ausreichende schöpferische Leistung zu erblicken ist, weil es andernfalls an der erforderlichen Eigentümlichkeit fehlt (BGH GRUR 1959, 289 [290] – Rosenthal-Vase; BGH GRUR 1961, 635, [6379 Stahlrohrstuhl II). cc) Nur solche Merkmale eines Gebrauchsgegenstands können Urheberrechtsschutz begründen, die nicht allein technisch bedingt, sondern auch künstlerisch gestaltet sind. Technisch bedingt sind diejenigen Merkmale eines Gebrauchsgegenstands, ohne die er nicht funktionieren könnte. Dazu gehören sowohl Merkmale, die bei gleichartigen Erzeugnissen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, als auch Merkmale, die zwar aus technischen Gründen verwendet werden, aber frei wählbar oder austauschbar sind. Soweit die Gestaltung solcher Merkmale allein auf technischen Erfordernissen beruht, können sie einem Gebrauchsgegenstand keinen Urheberrechtsschutz verleihen. Das folgt bereits daraus, dass nach § 2 Abs. 2 UrhG nur persönliche geistige Schöpfungen als Werke urheberrechtlich geschützt sind. Eine persönliche geistige Schöpfung ist ausgeschlossen, wo für eine künstlerische Gestaltung kein Raum besteht, weil die Gestaltung durch technische Erfordernisse vorgegeben ist. … dd) Für die Beurteilung kommt es allein auf die Anschauungen zum Zeitpunkt der Schöpfung an. Ein etwaiger Wandel der Anschauungen ist nicht zu berücksichtigen (BGH GRUR 1961, 635 [638] – Stahlrohrstuhl). Der Umstand, dass der Käfer – aus streitigen Gründen – später, nach der klägerischen Einschätzung, zur Designikone, zum Kultobjekt und zum Kunstgegenstand wurde, bleibt unberücksichtigt. 8. Ausgehend von diesen Grundsätzen stellen die Zeichnungen in den Anlagen K7 und K8 kein schutzfähiges Werk dar. a) Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits einen umfangreichen Formenschatz, der die wesentlichen Gestaltungselemente der Zeichnungen in den Anlagen K7 und K8 vorwegnimmt. Der Prototyp des Tatra V570 (1931) war wie folgt gestaltet: … Das Konzept von Barényi von 1926 (Anlage B8) war wie folgt gestaltet: … Der Mercedes Typ 130h war wie folgt gestaltet: … Der Standard Superior von 1033 (B23) war wie folgt gestaltet: … Der NSU Typ 32 ist nicht K. zuzuordnen (vgl. o.) Er war wie folgt gestaltet: … b) Bei der Gestaltungsfreiheit für Kraftfahrzeuge bestehen Besonderheiten. Es sind zahlreiche technische Vorgaben einzuhalten. Das gilt in erster Linie für die Stabilität des Fahrzeugs in Aufbau und Materialauswahl z. B. hinsichtlich Torsions- und Biegesteifigkeit der in der Regel selbsttragenden Karosserie, die Aerodynamik („cw-Wert"), die Funktionsfähigkeit sichtbarer Teile (z. B. versenkbare Seitenscheiben), die Fertigungs- und Reparaturfreundlichkeit, die optischen Bedingungen (z. B. Position der Leuchten, Neigungswinkel für verzerr- und blendfreie Frontscheibe), aber auch für passive Elemente wie Unfall- oder Aufprallschutz von fremden Verkehrsteilnehmern usw. (vgl. etwa Balzer et al., Hdb. d. Kfz-Technik, Bd. 2, S. 76 ff. [Karosserietechnik]; Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 24. Aufl. [2002], S. 792 ff.). Der Gestaltungsfreiheit eines Designers sind damit von vornherein Grenzen gesetzt, da die Technizität der Gebrauchstauglichkeit selbst bei großzügiger Abwandlung des Prototyps Auto stets dominant bleibt (so BPatG GRUR 2005, 330 – Fahrzeugkarosserie). Zutreffend hat das Landgericht Stuttgart für den P. 911 darauf hingewiesen, dass zahlreiche Gestaltungsmerkmale technisch vorgegeben sind. Dies gilt u. a. für die Anbringung der Frontscheinwerfer die am rechten und linken Fahrzeugrand angebracht werden müssen. Die Vorgabe des möglichst geringen Luftwiderstandes konnte durch die integrierten und schräggestellten Schweinwerfer weiter umgesetzt werden. Die Kotflügel müssen geeignet sein, die darunterliegenden Räder abzudecken. Die technische Entscheidung, den luftgekühlten Motor des Fahrzeuges im Heck unterzubringen, hat zur Konsequenz, dass Lüftungsschlitze oder ein Kühlergrill an der Front nicht erforderlich sind. Stattdessen sind Lüftungsschlitze am Heck vorzusehen. Hier gab es durch das gegebene Fahrzeugkonzept (Exposé Anlage B5) zahlreiche technische Vorgaben. Vorgesehen war ein Rohrrahmen mit Einzelradaufhängung, der Heckmotor mit Heckantrieb. Die technischen Elemente „Zentralrohrrahmen" und „Heckmotor" waren dabei schon vom Tatra V570 und dem Konzept von Barényi bekannt (Klageschrift S. 15). Die Karosserie sollte die ideale Stromlinienform einhalten und einen möglichst großen Fahrgastraum enthalten. c) Die Elemente, die einen Werkschutz der Zeichnungen in den Anlagen K7 oder K8 begründen könnten, sind daher zum Teil technisch bedingt aber im Wesentlichen dem vorbekannten Formenschatz entnommen. … Unter Berücksichtigung des vorbekannten Formenschatzes und der technischen Vorgaben kann bei den Zeichnungen nach der im Leben herrschenden Anschauung nicht von Kunst gesprochen werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Gestaltung in den 1930er Jahren der Anregung des ästhetischen Gefühls durch Anschauung dienen sollte. Es ging nicht um Kunst, sondern um eine technische Lösung. Es sollte ein reiner Gebrauchsgegenstand geschaffen werden. In der von der Klägerin vorgelegten Anlage K24 heißt es auf S. 35 zur „Volkswagen-Karosserie": „ihre Form ergab sich aus den damaligen Tendenzen zur „Stromlinie und aus dem vom P. aufgestellten Lastenheft" (…). In dem Exposé (Anlage B5) spielte die Gestaltung zunächst keine Rolle. Im Anhang geht es zunächst um das Fahrgestell und technische Vorgaben zu Rahmen, Federung, Lenkung usw. Auch bei der Karosserie stehen technische Vorgaben bzw. Wirkungen im Vordergrund: Anpassung an die Stromlinienform, bequeme Sitzverteilung, leichte Anbringung des Wagenkastens, geringer Luftwiderstand. Erst ganz zum Schluss wird das „harmonische Aussehen" erwähnt. Dies wird auch im Kommentar der Autozeitung von 1933 zum Mercedes Typ 130 deutlich. Die äußere Form wird wegen des technisch überlegenen Konzepts in Kauf genommen. Der Arbeitsvertrag von 1931 (Anlage K1a) hat auch nicht die Gestaltung mit künstlerischem Anspruch, sondern die „Lösungen auf motorischem und fahrzeugtechnischen Gebiete" im Blick. Dass es um Technik und nicht um besonders ästhetische Gestaltung ging, zeigt auch der Umstand, dass es im Laufe der Entwicklung zahlreiche Änderungen und Varianten gab (Anlage B7). Es sollte die beste technische Lösung gefunden werden und nicht ein künstlerisches Design. Alle Belege für die besondere Wirkung des Designs des Käfers stammen nicht aus der Zeit der Schöpfung, sondern sind Jahrzehnte später entstanden. d) … Wie das Landgericht Stuttgart (S. 37) ist auch die Kammer der Auffassung, dass die Ausführungen der Klägerin zur angeblichen Umsetzung des Goldenen Schnittes für die Beurteilung der künstlerischen Leistung nicht maßgeblich sind. Der Goldene Schnitt ist eine seit der Antike bekannte Gestaltungsregel und bezeichnet das Teilungsverhältnis zweier Größen zueinander. Eine Strecke wird so unterteilt, dass das Verhältnis der kleineren Teilstrecke (b) zur größeren Teilstrecke (a) dem der größeren Strecke zur Gesamtstrecke (a+b) entspricht. Das ergibt die Formel a / b = ( a + b ) / a (https://www.whitewall.com/de/mag/goldener-schnitt abgerufen 31.05.2019 um 09:59). Dieses Verhältnis soll als besonders harmonisch empfunden werden. Nach Auffassung der Kammer ist die Anwendung des Goldenen Schnittes für die Beurteilung der Werkqualität nur sehr eingeschränkt geeignet. Ellipsen, Diagonalen, „goldene Dreiecke" und „goldene Rechtecke" lassen sich letztlich in beliebiger Weise über ausgewählte Objekte legen, um vermeintliche Übereinstimmungen zu belegen. Kritiker sprechen davon, dass beim Zeichnen der Dreiecke Teile der Objekte ignoriert werden (vgl. Markowsky, Misconceptions about the Golden Ratio abgerufen unter https://www.math.cuhk.edu.hk/~pschan/uged1533/markowsky.pdf am 31.05.2019 um 10:20 Uhr) oder Zirkel beliebig angesetzt werden (https://www.suedkurier.de/ueberregional/kultur/Der-Goldene-Schnitt-und-die-Schoenheit-der-idealen-Proportion;art10399,9212504, abgerufen am 31.05. 2019 um 10:25 Uhr) man „könne den Goldenen Schnitt irgendwie in jedes Gebäude, jedes Gemälde etc. hineinmessen" (Peter, immer schön kritisch bleiben, http://www.bernhardpeter.de/Heraldik/Goldsch/seite595.htm abgerufen am 31.05.2019 um 10:30; vgl. auch Brownlee, The Golden Ratio; Designs Biggest Myth, abgerufen Uhr https://www.fastcompany.com/3044877/the-golden-ratio-designs-biggest-mytham 31.05.2019 um 10:40 Uhr). Es kommt für die urheberrechtliche Beurteilung auf den Gesamteindruck und nicht auf eine geometrische Analyse an. Soweit nach dem Vortrag der Klägerin die Regeln des Goldenen Schnitts schon seit Jahrtausenden Anwendung finden, läge in ihrer Umsetzung für die Gestaltung eines Gebrauchsgegenstandes auch keine besondere künstlerische Leistung e) Die Herrn K. nach Auffassung der Klägerin zuzurechnenden Zeichnungen in den Anlagen K7 und K8 stellen daher kein schutzfähiges Werk da. 9. Nach Auffassung der Kammer wäre dies auch dann der Fall, wenn man annehmen würde, dass auch für vor 1966 geschaffene Werke der angewandten Kunst die herabgesetzte Schutzschwelle der „Geburtstagszug-Entscheidung" gelten würde. Nach der neueren Rechtsprechung des BGH genügt auch für angewandte Kunst, dass sie eine Gestaltungshöhe erreicht, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen" Leistung zu sprechen. Auch wenn bei Werken der angewandten Kunst keine höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines Werkes zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien Kunst, ist bei der Beurteilung, ob ein solches Werk die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen. Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt. Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maße die Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt (GRUR 2014, 175, Tz. 26, 41 – Geburtstagszug). … 10. Auch wenn man entgegen der Auffassung der Kammer nicht auf die Zeichnungen in den Anlagen K7 und K8 sondern den Ur-Käfer abstellt, bleibt es sowohl nach dem alten strengen Maßstab als auch nach den „Geburtstagszug-Grundsätzen" bei der Schutzunfähigkeit … 11. Für den Fall, dass – entgegen der Auffassung der Kammer – von einem schutzfähigen Werk auszugehen wäre, würden der Klägerin keine Ansprüche aus § 32a UrhG zustehen, da die ab 2014 produzierten Modelle Beetle und Käfer weder eine Vervielfältigung (§ 16 UrhG) noch eine unfreie Bearbeitung (§ 23 UrhG) darstellen. Den Gestaltungen, auf die sich die Klägerin stützt, kommt angesichts des Gebrauchszwecks nur ein enger Schutzbereich zu, der unter Berücksichtigung der erheblichen Weiterentwicklungen der Karosserieform in den aktuellen Modellen nicht verletzt ist. Es liegt lediglich eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) vor."
Eine andere Beurteilung der Werkqualität folgt auch nicht aus dem von der Klägerin vorgelegten Gutachten (Anlagen K67, a), b)).
Mit Verfügungs-Urteil vom 3. März 2022 (Az. 14 O 366/21) hat das LG Köln festgestellt, dass Schuhmodelle (streitgegenständlich waren Sandalen) als "Werke der angewandten Kunst" i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 2 UrhG urheberrechtlichen Schutz genießen können, wenn ihre ästhetische Wirkung (sic!) auf einer hinreichend künstlerischen, und nicht nur auf einer 'technischen' Leistung beruht (vgl. dazu die Entscheidungen BGH – Seilzirkus und BGH – Geburtstagszug); bei dieser Bewertung soll nicht nur das Design als solches, sondern auch der konkrete Schaffensprozess zu berücksichtigen sein: ... mehr "1. Die streitgegenständlichen Schuhmodelle "B " und "H " stellen persönliche geistige Schöpfungen im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG dar. a) Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gehören Werke der bildenden Kunst einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke zu den urheberrechtlich geschützten Werken, sofern sie nach § 2 Abs. 2 UrhG persönliche geistige Schöpfungen sind. Eine persönliche geistige Schöpfung ist eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer »künstlerischen« Leistung gesprochen werden kann (BGH, Urteil vom 29.4.2021 – I ZR 193/20, ZUM 2021, 1040, 1047 – Zugangsrecht des Architekten; st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1983, 377, 378, juris Rn. 14 – Brombeer-Muster; GRUR 1987, 903, 904, juris Rn. 28 – Le-Corbusier-Möbel; ZUM-RD 2011, 457, Rn. 31 – Lernspiele; ZUM 2012, 36 Rn. 17 – Seilzirkus; BGHZ 199, 52 = ZUM 2014, 225 Rn. 15 – Geburtstagszug). Dabei kann die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen, soweit sie auf einer künstlerischen Leistung beruht und diese zum Ausdruck bringt (BGH ZUM 2012, 36 Rn. 36 – Seilzirkus; BGHZ 199, 52 = ZUM 2014, 225 Rn. 41 – Geburtstagszug). Mit Blick auf die Neugestaltung des Geschmacksmusterrechts durch das Geschmacksmusterreformgesetz vom 12.03.2004 und auf die europäische Urheberrechtsentwicklung hat der BGH seine zuvor bestehende Rechtsprechung aufgegeben, wonach bei Werken der angewandten Kunst höhere Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines Werks zu stellen sind als bei Werken der zweckfreien Kunst (BGHZ 199, 52 = ZUM 2014, 225 Rn. 17 bis 41 – Geburtstagszug). Für einen urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst und der bildenden Kunst ebenso wie für alle anderen Werkarten ist allerdings gleichwohl eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern (vgl. BGHZ 199, 52 = ZUM 2014, 225 Rn. 40 – Geburtstagszug; BGH ZUM 2015, 996 Rn. 44 – Goldrapper). b) In der Sache sollen diese Maßstäbe dem unionsrechtlichen Begriff des urheberrechtlich geschützten Werkes im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft entsprechen (vgl. Koch GRUR 2021, 273 [274 f.]). Dabei handelt es sich nach der Rechtsprechung des EuGH um einen autonomen Begriff des Unionsrechts, der in der gesamten Union einheitlich auszulegen und anzuwenden sein soll (EuGH, ZUM 2019, 56 Rn. 33 – Levola Hengelo; ZUM 2019, 834 Rn. 29 – Cofemel). Für eine Einstufung eines Objekts als Werk müssen danach zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Original in dem Sinne handeln, dass er eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt (EuGH, ZUM 2019, 56 Rn. 36 – Levola Hengelo; ZUM 2019, 834 Rn. 29 – Cofemel; ZUM 2020, 609 Rn. 22 – Brompton). Ein Gegenstand kann erst dann, aber auch bereits dann als ein Original in diesem Sinne angesehen werden, wenn er die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen freie kreative Entscheidung zum Ausdruck bringt. Wurde dagegen die Schaffung eines Gegenstands durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt, die der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand die für die Einstufung als Werk erforderliche Originalität aufweist (EuGH ZUM 2019, 834 Rn. 30 f. – Cofemel; ZUM 2020, 609 Rn. 23 f. – Brompton). Zum anderen ist die Einstufung als Werk Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen (EuGH ZUM 2019, 56 Rn. 37 – Levola Hengelo; ZUM 2019, 834 Rn. 29 – Cofemel; ZUM 2020, 609 Rn. 22 – Brompton). Dafür ist ein mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbarer Gegenstand Voraussetzung (EuGH, ZUM 2019, 834 Rn. 32 – Cofemel; ZUM 2020, 609 Rn. 25 – Brompton), auch wenn diese Ausdrucksform nicht notwendig dauerhaft sein sollte (EuGH ZUM 2019, 56 Rn. 40 – Levola Hengelo). … d) Das Vorhandensein einer Schöpfung, von Individualität und Originalität lässt sich nicht allein aus den objektiven Eigenschaften des jeweiligen Werkes herleiten. Vielmehr sind diese Merkmale anhand ihrer Relation zum konkreten Schaffensprozess zu betrachten. Die Werk-Schöpfer-Beziehung kann weder aus einer einseitigen Betrachtung der Person des Urhebers heraus noch durch Analyse seines Werkes allein adäquat erfasst werden (grundlegend Haberstumpf, GRUR 2021, 1249, 1251; Barudi, Autor und Werk – eine prägende Beziehung?, 2013, 32 f.). Maßgeblich ist vielmehr, nach welchen Regeln der Urheber eines bestimmten Werkes gearbeitet hat, wohingegen keine Rolle spielt, ob er sich dessen bewusst war. Erst dann, wenn keine bestehenden Regeln vorgeben, wie der Erschaffer eines Produkts auf einem bestimmten Gebiet dieses zu fertigen hat – etwa anhand von erlernten Verarbeitungstechniken und Formgestaltungsregeln – bestehen keine Gestaltungsspielräume mehr, mit der Folge, dass die Entfaltung von Individualität dann nicht mehr möglich ist, selbst wenn ein handwerklich in Perfektion gefertigtes Produkt neu und eigenartig ist, also durchaus Designschutz beanspruchen könnte. Die rein handwerkliche oder routinemäßige Leistung trägt nicht den Stempel der Individualität, mag sie auch noch so solide und fachmännisch erbracht sein (Leistner, in: Schricker/Loewenheim, 6. Aufl. 2020, § 2, Rn. 53). Der Hersteller muss den bestehenden Gestaltungsspielraum indes auch durch eigene kreative Entscheidungen ausfüllen, um zum Urheber zu werden (BGH, GRUR 2014, 175, Rn. 41 – Geburtstagszug). Dies bedeutet, dass das schöpferische Individuum kein Produkt aus Regeln ist, sondern selbst eine Regel für das Urteil über andere Produkte, also exemplarisch sein muss. Die technische Bedingtheit eines Produkts durch die Anwendung technischer Regeln und Gesetzmäßigkeiten kann den Spielraum des Gestalters beschränken, wenn eine technische Idee mit einer bestimmten Ausdrucksform zusammenfällt, diese Ausdrucksform technisch notwendig ist und damit schöpferisches Gestalten unmöglich macht (vgl. Zech, ZUM 2020, 801, 803). Technische Lehren können Spielräume des Gestalters aber auch erweitern, etwa, wenn dieser sich die kausalen Eigenschaften bestimmter Materialien oder vorhandener Gegenstände gerade zunutze macht, um mit diesen zu experimentieren, sie zu kombinieren und auszuloten, welche Gestaltungsmöglichkeiten sie bieten (Haberstumpf, GRUR 2021, 1249, 1253). So kann beispielsweise die Licht- und Farbwirkung von geschliffenem Kristallglas dazu beitragen, Tierfiguren als schutzfähig anzusehen (BGH, GRUR, 1988, 690, 692 f.). Technische Regeln und Gesetzmäßigkeiten stehen einer schöpferischen Gestaltung also nur dann entgegen, wenn sie zwingende Wirkung entfalten, indem der Gestalter sich an bestehende Konventionen hält und diese befolgt, ohne von ihnen abzuweichen, sie zu modifizieren oder sich über sie hinwegzusetzen. Der Gestalter eines Produkts nutzt die ihm eröffneten Gestaltungsspielräume nicht, wenn er sich an vorgegebenen Techniken und Regeln orientiert. Zu einem schöpferischen Werk wird sein Produkt erst dann, wenn er von vorhandenen und praktizierten Gestaltungsgepflogenheiten abweichende Regeln in das jeweils in Anspruch genommene Kommunikationssystem explizit oder implizit einführt und danach handelt, indem er ein materielles Erzeugnis produziert, das als Beispiel oder Muster für seine selbstgesetzten Regeln dienen kann (Haberstumpf, GRUR 2021, 1249, 1256). Abzustellen ist nicht in erster Linie auf einzelne Gestaltungselemente, sondern auf den Gesamteindruck, den das Werk dem Betrachter vermittelt (OLG Hamburg, GRUR 2002, 419, 420). Der Schöpfungsprozess ist daraufhin zu analysieren, ob der Urheber sich ausschließlich an Vorgegebenem orientiert und die Spielräume nicht durch eigene Entscheidungen ausgefüllt hat. Lässt sich ausschließen, dass ein Gestalter vollständig nach vorgegebenen Regeln gearbeitet hat, ist zu folgern, dass er jedenfalls in gewissem Umfang eigene schöpferische Entscheidungen getroffen hat. Dann spricht eine Vermutung dafür, dass er den gegebenen Gestaltungsspielraum tatsächlich genutzt hat, um sein geistiges Produkt hervorzubringen. Der anspruchstellende Urheber genügt danach seiner Obliegenheit, die Schutzfähigkeit seines Werkes darzulegen, und glaubhaft zu machen, regelmäßig dadurch, dass er ein Werkexemplar vorlegt und seine Besonderheiten präsentiert (vgl. BGH, GRUR 1981, 820, 822 – Stahlrohrstuhl III). Verteidigt sich der wegen Urheberrechtsverletzung in Anspruch Genommene mit dem Einwand, das streitgegenständliche Werk sei nicht schutzfähig oder der Schutzumfang sei eingeschränkt, weil der Urheber auf vorbekannte Gestaltungen zurückgegriffen habe, muss dieser die Existenz und das Aussehen solcher Gestaltungen darlegen und beweisen. e) Nach Maßgabe dieser Grundsätze sind streitgegenständlichen Sandalenmodelle "B " und "H " urheberrechtlich geschützt. …"
We are looking for a trainee lawyer and scientific assistant for the legal and also the elective station. In addition to the training in the legal clerkship, there is the possibility of scientific work. Desirable: Solid prior knowledge of competition law and/or copyright/commercial. legal protection (trademark law); willingness to perform; preferably first law firm experience; Enjoying the law & providing comprehensive support for (young/small & medium-sized) companies and entrepreneurs. Please send a short application to vy@verweyen.legal!
Die Kanzlei Gutsch & Schlegel aus Hamburg mahnt erneut Medienhändler und Online-Antiquariate/recommerce-Anbieter wegen des Verkaufs sogenannter Bootlegs (nicht lizenzierte Aufnahmen, meist Mitschnitte von Live-Aufnahmen) ab, zur Zeit vermehrt für die Experience Hendrix, LL.C., die angeblich die Auswerztungsrechte des Musikers Jimi Hendrix vertritt. Gutsch & Schlegel macht Ansprüche auf Unterlassen und Vernichtung, Auskunft und Schadensersatz sowie Kostenersatz (Kosten für die Abmahnung) geltend. Es lohnt sich, diese Abmahnungen genau zu prüfen/prüfen zu lassen und keine vorschnellen Zugeständnisse zu machen. Grundsätzlich muss der (angebliche) Rechteinhaber / Gutsch & Schlegel den behaupteten Rechtsverstoß (Bootlegs, Piracy, Grau-/Parallelimport, etc.) nachweisen und dazu insb. die Rechteinhaberschaft und Anspruchsberechtigung lückenlos über die gesamte Rechtekette nachweisen. ... mehr Auch in Bezug auf die geltend gemachte Erstattung der Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzforderungen lohnt ein genauer Blick. Insbesondere ist die außergerichtliche Inanspruchnahme mehrerer Schädiger nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebührenrechtlich i.d.R. als eine Angelegenheit anzusehen, wodurch nur ein Bruchteil der von Gutsch & Schlegl regelmäßig eingeforderten Gebühren erstattet werden muss (Urteil BGH – Der Novembermann; erneut BGH, Urteil vom 22.01.2019, Az. VI ZR 402/17 – Ermittlungen gegen Schauspielerin). Kosten für die Ermittlung der angeblichen Rechtsverletzung durch die GUMPS GmbH (Geschäftsführer sind auch hier die Rechtsanwälte Gutsch und Schlegel)sind i.d.R. ebenfalls nicht geschuldet, und wurden von den Gerichten bereits in mehreren Verfahren zurückgewiesen. RAe Gutsch & Schlegel gehen zudem auch wegen angeblicher Bootleg-Aufnahmen der Musiker/Musikgruppen u.a. gegen Medienhändler, Online-Antiquariate und Gebraucht-Medien-Händler (recommerce), sowie gegen private Anbieter (eBay-Verkäufe), vor. In den meisten Fällen konnten wir erreichen, dass gegen unsere Mandanten keine Klagen eingereicht wurden und Kosten und Schadensersatzforderungen außergerichtlich abwehren. Zudem konnten wir Klagen meist erfolgreich abwehren, u.a. Klagen betreffend die Musikgruppen/Musiker Iron Maiden, Genesis, Phil Collin; Klagen der Kanzlei Gutsch & Schlegel wurden in diesen Fällen abgewiesen (Amts- und Landgericht Hamburg).
Die Kanzlei Gutsch & Schlegel aus Hamburg mahnt erneut Medienhändler und Online-Antiquariate/recommerce-Anbieter wegen des Verkaufs sogenannter Bootlegs (nicht lizenzierte Aufnahmen, meist Mitschnitte von Live-Aufnahmen) ab, zur Zeit vermehrt für den Musiker Eric Clapton bzw. Eric Patrick Clapton. Gutsch & Schlegel macht Ansprüche auf Unterlassen und Vernichtung, Auskunft und Schadensersatz sowie Kostenersatz (Kosten für die Abmahnung) geltend. Es lohnt sich, diese Abmahnungen genau zu prüfen/prüfen zu lassen und keine vorschnellen Zugeständnisse zu machen. Grundsätzlich muss der (angebliche) Rechteinhaber / Gutsch & Schlegel den behaupteten Rechtsverstoß (Bootlegs, Piracy, Grau-/Parallelimport, etc.) nachweisen und dazu insb. die Rechteinhaberschaft und Anspruchsberechtigung lückenlos über die gesamte Rechtekette nachweisen. ... mehr Verschiedentlich habe sich die Abmahnungen von Rechtsanwälten Gutsch & Schlegel auch als rechtsmissbräuchlich erwiesen! So hat der Bundesgerichtshof BGH mit Urteil vom 28. Mai 2020, Az. I ZR 129/19, eine Abmahnung der Kanzlei Gutsch & Schlegel anhand mehrerer Kriterien als rechtsmissbräuchlich und damit als "nicht berechtigt" i.S.v. § 97a Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 4 UrhG befunden und hat die auf Ersatz der Kosten für die Abmahnung gerichtete Klage der Kanzlei Gutsch & Schlegel vollumfänglich abgewiesen! Auch in Bezug auf die geltend gemachte Erstattung der Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzforderungen lohnt ein genauer Blick. Insbesondere ist die außergerichtliche Inanspruchnahme mehrerer Schädiger nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebührenrechtlich i.d.R. als eine Angelegenheit anzusehen, wodurch nur ein Bruchteil der von Gutsch & Schlegl regelmäßig eingeforderten Gebühren erstattet werden muss (Urteil BGH – Der Novembermann; erneut BGH, Urteil vom 22.01.2019, Az. VI ZR 402/17 – Ermittlungen gegen Schauspielerin). Kosten für die Ermittlung der angeblichen Rechtsverletzung durch die GUMPS GmbH (Geschäftsführer sind auch hier die Rechtsanwälte Gutsch und Schlegel)sind i.d.R. ebenfalls nicht geschuldet, und wurden von den Gerichten bereits in mehreren Verfahren zurückgewiesen. RAe Gutsch & Schlegel gehen zudem auch wegen angeblicher Bootleg-Aufnahmen der Musiker/Musikgruppen u.a. gegen Medienhändler, Online-Antiquariate und Gebraucht-Medien-Händler (recommerce), sowie gegen private Anbieter (eBay-Verkäufe), vor. In den meisten Fällen konnten wir erreichen, dass gegen unsere Mandanten keine Klagen eingereicht wurden und Kosten und Schadensersatzforderungen außergerichtlich abwehren. Zudem konnten wir Klagen meist erfolgreich abwehren, u.a. Klagen betreffend die Musikgruppen/Musiker Iron Maiden, Genesis, Phil Collin; Klagen der Kanzlei Gutsch & Schlegel wurden in diesen Fällen abgewiesen (Amts- und Landgericht Hamburg).
Ein Urteil des Amtsgerichts Oldenburg (Urteil vom 17. April 2015, Az. 8 C 8028/15; nicht rechtskräftig) wirft einige interessante Fragen zur urheberrechtlichen Haftung von Designern_innen bei Auftragsarbeiten auf: ... mehr 1. Muss ein_e Designer_in für "rechtswidriges" Material wie z.B. Stockfotos einstehen, das er_sie für ein bestimmtes Projekt beschafft? Der Designer muss ein mangelfreies Werk (im Falle des AG Oldenburg eine Website; nichts anders gilt aber z.B. für Broschüren oder sonstige Werbemittel) herstellen und abliefern. Dieses Werk muss auch von Rechtsmängeln frei sein. Sind die Rechte an dem hergestellten Werk bzw. an Teilen des Werks (z.B. eingebettete Stockfotos) nicht hinreichend geklärt, so stellt dies einen Rechtsmangel dar, für den der Designer einstehen muss. Der Designer haftet seinem Auftraggeber (im Innenverhältnis) dann zunächst auf Herstellung eines (rechts-) mangelfreien Werks (Nachbesserung; Gewährleistung). Diese Haftung kann auch Schadensersatzansprüche des Auftraggebers umfassen, insb. wenn der Auftraggeber von einem Rechteinhaber auf Unterlassen, Ersatz von Anwaltskosten sowie ggf. Prozesskosten und Schadenersatz in Anspruch genommen wurde (Regress). Der Designer haftet zudem auch im Außenverhältnis, also ggü. den Rechteinhabern, und kann von diesen neben dem Auftraggeber (Betreiber der Website) in Anspruch genommen werden. Urheberrechtlich gesprochen macht der Betreiber der Website die rechtswidrigen Inhalte "öffentlich zugänglich" (§ 19a UrhG), während der Designer diese Inhalte vervielfältigt (§ 16 UrhG) und ggf. bearbeitet hat (§ 23 UrhG). Dies alles sind Handlungen und Nutzungen, die nach dem Urheberrecht allein dem Rechteinhaber vorbehalten sind. Das AG Oldenburg geht dabei von einer gleichwertigen Gesamtschuld von Auftraggeber und Designer aus. Nach der BGH-Entscheidung zum "Tripp-Trapp-Stuhl" ist aber wohl eher von einer Verletzerkette auszugehen, bei der Auftraggeber und Designer jeweils eigene (deliktische) Urheberrechtsverletzungen begehen und dafür im Außenverhältnis jeweils "voll" einstehen müssen. Der Auftraggeber kann dann aber im Innenverhältnis (vollen) Regress bei dem Designer nehmen, so dass im Ergebnis der Designer den wirtschaftlichen Schaden — vorbehaltlich einer Verletzung von Schadensminderungspflichten durch den Auftraggeber: allein — zu tragen hat. 2. Was ist mit Material (z.B. Fotografien und Zeichnungen, Logos, Texte), das der Auftraggeber dem_der Designer_in beistellt, damit er_sie es in die Website oder Broschüre einbaut? Nach Ansicht des AG Oldenburg ändert sich an der Haftung (Gewährleistung; ggf. Schadensersatz/Regress) des Designers auch dann nichts, wenn die "rechtswidrigen" Inhalte vom Auftraggeber selbst beigesteuert wurden. Der Designer muss auch solches Material (im Fall des AG Oldenburg ging es um einen Kartenausschnitt) daraufhin prüfen, ob die Rechte daran geklärt sind; tut er dies nicht bzw. nicht ausreichend, so stellt dies eine Vertragsverletzung dar und löst eine Haftung (auch) des Designers in Innen- und Außenverhältnis aus. Denn als "Fachunternehmen" sei der Designer verpflichtet, sich über etwaige Urheberrechte Dritter zu informieren, insb. (aber wohl nicht nur) wenn leicht zu erkennen ist, dass das Material (Fotografie, Kartenausschnitte, Illustrationen, etc.) von einem "Profi" erstellt wurde, also nicht vom Auftraggeber selbst erstellt worden sein kann. Zudem bestehe eine vertragliche Hinweis- und Beratungspflicht des Designers ggü. seinen Kunden. "Es entspricht der üblichen Sorgfaltspflicht im Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken, dass man die Berechtigung zur Nutzung des Werks prüft und sich darüber Gewissheit verschafft (BGH GRUR 1960, 606, 609; GRUR 1959, 331, 334). Insoweit bestehen strenge Sorgfaltsanforderungen. Verwerter müssen sich umfassend und lückenlos nach den erforderlichen Rechten erkundigen (Prüfungspflicht) und die Kette der einzelnen Rechtsübertragungen vollständig prüfen, wobei Gewerbetreibende erhöhten Prüfungsanforderungen unterliegen (BGH GRUR 1988, 373, 375; GRUR 1991, 332, 333)." Bei Material, das der Auftraggeber beistellt, trifft nach Ansicht des AG Oldenburg sowohl den Auftraggeber, als auch den Auftragnehmer (Designer) eine eigene Prüfpflicht. Der Auftraggeber kann sich also nicht damit entlasten, dass er mit dem Designer ein "Fachunternehmen" mit der Erstellung der Website beauftragt hat, zumal er die Verwendung des rechtswidrigen Materials initiiert hat. Der Designer ist verpflichtet, auch Material, das ihm von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, auf bestehende Urheber- und sonstige Schutzrechte zu überprüfen (und wohl auch auf Wettbewerbsverstöße, z.B. bei der Konzeption von Marketingmaßnahmen). Nach Ansicht des AG Oldenburg gilt dies umso mehr, wenn leicht zu erkennen ist, dass das beigesellte Material von einem professionellen Kartografen, Designer oder Urheber stammt und nicht vom Auftraggeber selbst erstellt worden sein kann (oder wenn es sonst offensichtlich rechtsbemakelt ist). 3. Kann der_die Designer_in diese Haftung ausschließen oder sich davon freistellen lassen, insb. in AGB? Eine solche Klausel verstößt nach Ansicht des AG Oldenburg gegen AGB-Recht (§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB) und ist unwirksam, denn die Erstellung eines den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Internetauftritts und die Prüfungs- und Hinweispflicht betreffend Urheberrechte und sonstige Schutzrechte Dritter sind wesentliche Vertragspflichten des (Web-) Designers (vgl. § 633 Abs. 1 BGB) und können nicht durch AGB auf den Auftraggeber abgewälzt werden; gleiches gilt für sonstige Rechtsverstöße, bspw. gegen wettbewerbsrechtliche Vorgaben im Bereich der Werbung / Marketing. (Bei Vereinbarungen mittels AGB ist zudem immer zu beachten, das diese rechtzeitig und wirksam in einen Vertrag einbezogen werden müssen.) Eine Hinweispflicht kann nach Ansicht des AG Oldenburg allenfalls dann entfallen, wenn der Auftraggeber wegen der Geringfügigkeit der Vergütung nicht mit einer entsprechenden Überprüfung durch den Designer rechnen kann. 4. Was also kann der_die Designer_in zu seinem_ihren eigenen Schutz tun? "Die Parteien eines Architektenvertrags können im Rahmen der Privatautonomie vereinbaren, dass und in welchem Umfang der Auftraggeber rechtsgeschäftlich das Risiko übernimmt, dass die vom Architekten zu erstellende Planung nicht genehmigungsfähig ist …. Da ein Architektenvertrag einem dynamischen Anpassungsprozess unterliegt, kann eine derartige vertragliche Risikoübernahme durch den Auftraggeber auch nach Vertragsschluss im Rahmen der Abstimmung über das geplante Bauvorhaben erfolgen. Voraussetzung für die vertragliche Risikoübernahme durch den Auftraggeber ist, dass dieser Bedeutung und Tragweite des Risikos erkannt hat, dass die Genehmigung nicht erteilt oder widerrufen wird. Das kann – sofern es nicht bereits offenkundig ist – in der Regel nur angenommen werden, wenn der Architekt den Auftraggeber umfassend über das bestehende rechtliche und wirtschaftliche Risiko aufgeklärt und belehrt hat und der Auftraggeber sich sodann auf einen derartigen Risikoausschluss rechtsgeschäftlich einlässt…" Eine solche Vereinbarung, ergänzt durch eine Haftungs- und Freistellungsvereinbarung, sollte aber nicht im "Kleingedruckten" versteckt werden. Dieser wichtige Punkt in der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Designer sollte – nicht anders als das Honorar des Designers und der Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte – in jedem Einzelfall individuell ausgehandelt werden sowie bereits im (schriftlichen) Angebot enthalten sein und an prominenter Stelle im Vertrag / Auftrag klar und deutlich geregelt werden. Darüber hinaus sollte der Designer seinen Auftraggeber immer ausführlich (und nachweisbar) darauf hinweisen, und dazu beraten, dass urheberrechtlich oder sonst geschütztes Material nur dann verwendet werden darf, wenn alle für die jeweilige Nutzung notwendigen Rechte und Einwilligungen wirksam eingeholt wurden. Bei Zweifel an der Rechtmäßigkeit beigeselltem Materials muss der Designer seine Auftraggeber darauf hinweisen. Bei allem wird der Designer nicht umhin kommen, auch selbst zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die notwendigen Rechte eingeholt wurden. Das gilt insb. bei Material, dass ersichtlich von einem Profi, und nicht vom Auftraggeber selbst erstellt wurde. Das wird letztlich erheblich auf die Angebotsgestaltung der Designer durchschlagen, denn sie werden eine nicht unerhebliche Kostenposition für die rechtliche Überprüfung und die Rechteklärung einplanen, und an ihre Auftraggeber weitergeben müssen. Stellt ein Designer bei der von ihm geforderten Überprüfung fest, dass er mit dem eingeholten oder beigesellten Material ein rechtsmangelfreies und damit vertragsgerechtes Werk nicht erstellen kann, und besteht der Auftraggeber dennoch auf der Nutzung (Einbettung) des Materials, so kann es für den Designer zur Vermeidung einer eigenen Haftung im Außenverhältnis sowie von Gewährleistungs- und Regressansprüchen des Auftraggebers ultima ratio angezeigt sein, die Ausführung dieses Auftrags zu verweigern; für den andernfalls resultierenden Mangel ist der Designer nur dann nicht verantwortlich, wenn er den Auftraggeber darauf hinweist, dass bei der gewünschten Beschaffenheit (Einbettung des rechtswidrigem Materials) ein mangelfreies Werk nicht hergestellt werden kann.
Der Haftungsmaßstab, den das AG Oldenburg unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH anlegt, ist ausgesprochen streng:
Eine Haftungsfreistellung oder ein Haftungsausschluss des Designers kann nach der überwiegenden Rechtsprechung nicht wirksam in den AGB des Designers vereinbart werden. Nach der strengen Ansicht des AG Oldenburg soll dies auch dann nicht möglich sein, wenn die rechtswidrigen Inhalte vom Auftraggeber selbst beigestellt und vom Designer nur in das Werk eingebettet wurden.
Bei (individuell vereinbarten) Freistellungsvereinbarungen ist zudem zu beachten, dass diese nur im Innenverhältnis zwischen Auftraggeber und Designern wirken und nicht verhindern können, dass (auch) der Designer von Rechteinhabern (im Außenverhältnis) in Anspruch genommen werden kann. In diesem Fall könnte der Designer lediglich seine Auftraggeber aus der Freistellungsvereinbarung in Regress nehmen und müsste dies ggf. im Klagewege gegen den Auftraggeber durchsetzen.
Auch wenn erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit eines formularmäßigen Haftungsausschluss oder einer Freistellungsvereinbarung bestehen, sollten Designer dennoch entsprechende Vereinbarungen mit ihren Auftraggebern treffen. Bevorzugt sollte dazu dem Auftraggebern vertraglich die (Mitwirkungs-) Pflicht aufgegeben werden, alle notwendigen Rechte an beigestelltem Material zu klären bzw. durch einen fachkundigen Rechtsanwalt klären zu lassen (Mitwirkungspflicht des Auftraggebers). Für Architektenverträge hat der BGH dies bereits wiederholt zugelassen (z.B. BGH, U.v. 10.2.2011, Az. VII ZR 8/10):
Mit Beschluss vom 10.02.2022, Az. I ZR 38/21, hat der Bundesgerichtshof BGH in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren dem Europäischen Gerichtshof EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vorgelegt, ob eine sog. Zufriedenheitsgarantie eine (objektive) Garantie im Sinne des (europäischen) Rechts (vgl. § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB) darstellt und damit durchsetzbar ist. ... mehr Die Beklagte warb in ihrem Online-Shop und an den streitgegenständlichen T-Shirts auf sog. Hang-Tags mit folgender Zufriedenheitsgarantie, die die Klägerin als unzureichend und damit unlauter i.S.v. 8 Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 1, § 3a UWG i.V.m. § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB ansieht: "L. Warranty Bei derartigen Zufriedenheitsgarantien ("completely satiesfied") stellt sich u.a. die Frage, ob die subjektive Unzufriedenheit eines Käufers, der sich auf die Garantie berufen will, anhand objektiver Kriterien wie z.B. Mängeln, fehlender Vertragsgemäßheit oder dem Zustand oder bestimmten Merkmalen der Kaufsache nachvollziehbar sein muss. U.a. diese Frage hat der BGH wie folgt dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt: " … Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 2 Nr. 14 der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher … sowie zur Auslegung von Art. 2 Nr. 12 der Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, … folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Kann eine andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderung im Sinne von Art. 2 Nr. 14 der Richtlinie 2011/83/EU und eine andere nicht mit der Vertragsmäßigkeit verbundene Anforderung im Sinne von Art. 2 Nr. 12 der Richtlinie (EU) 2019/771 vorliegen, wenn die Verpflichtung des Garantiegebers an in der Person des Verbrauchers liegende Umstände, insbesondere an seine subjektive Haltung zur Kaufsache (hier: die in das Belieben des Verbrauchers gestellte Zufriedenheit mit der Kaufsache) anknüpft, ohne dass diese persönlichen Umstände mit dem Zustand oder den Merkmalen der Kaufsache zusammenhängen müssen? 2. Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Muss das Fehlen von Anforderungen, die sich auf in der Person des Verbrauchers liegende Umstände (hier: seine Zufriedenheit mit den erworbenen Waren) gründen, anhand objektiver Umstände feststellbar sein?" Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts genügte die o.g. Garantieerklärung nicht den Anforderungen des § § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB a.F. / n.F. (BGH, a.a.O., Rz. 22): "Das Berufungsgericht hat angenommen, die auf den Hang-Tags angebrachte Erklärung der Beklagten weise nicht sämtliche durch § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB aF vorgeschriebenen Angaben auf. Sie enthalte weder einen Hinweis auf die gesetzlichen Rechte und ihre fehlende Einschränkbarkeit (§ 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB aF; nun § 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB nF) noch Angaben, ob und von wem der Käufer nach dem Inhalt der Garantie im Anschluss an die Rückgabe des Bekleidungsstücks den Kaufpreis zurückerhalte und welchen räumlichen Geltungsbereich die Garantie aufweise (§ 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB aF; nun § 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 5 BGB nF). Zudem seien die Firma und die Anschrift der Beklagten als Garantiegeberin nicht genannt (§ 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB aF; nun § 479 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB nF). Gegen diese tatgerichtlichen Feststellungen erhebt die Revision keine Einwendungen; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar." Allerdings muss eine Garantieerklärung die in § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB aufgeführten Informationen nur dann enthalten, wenn es sich überhaupt um eine Garantie im Sinne der §§ 443, 479 Abs. 1 BGB handelt; dies ist nach Absicht des BGH eine Frage des Europäischen Rechts und fraglich (BGH, a.a.O., Rz. 23 ff., Hervorhebung hier): "Die auf den Hang-Tags aufgedruckte Erklärung muss die durch § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB aF und nF (im Folgenden § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB) vorgeschriebenen Angaben nur enthalten, wenn es sich um eine Garantie im Sinne von § 479 Abs. 1, § 443 Abs. 1 BGB handelt. Fraglich ist, ob die Zusage der Be-klagten, der Käufer könne das erworbene Produkt zurückgeben, wenn er mit ihm nicht vollständig zufrieden sei, eine solche Garantie darstellt. a) Gemäß § 443 Abs. 1 BGB liegt eine Garantie vor, wenn der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer Erklärung oder einschlägigen Werbung, die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfügbar war, zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaftung insbesondere die Verpflichtung eingeht, den Kaufpreis zu erstatten, die Sache auszutauschen, nachzubessern oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen, falls die Sache nicht diejenige Beschaffenheit aufweist oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen nicht erfüllt, die in der Erklärung oder einschlägigen Werbung beschrieben sind. … Soweit der gesetzliche Garantiebegriff des § 443 Abs. 1 BGB unionsrechtlich determiniert ist, ist er richtlinienkonform auszulegen. bb) Nach Art. 1 Abs. 2 Buchst. e der Richtlinie 1999/44/EG bezeichnet im Sinne dieser Richtlinie der Ausdruck "Garantie" jede von einem Verkäufer oder Hersteller gegenüber dem Verbraucher ohne Aufpreis eingegangene Verpflichtung, den Kaufpreis zu erstatten, das Verbrauchsgut zu ersetzen oder nachzubessern oder in sonstiger Weise Abhilfe zu schaffen, wenn das Verbrauchsgut nicht den in der Garantieerklärung oder in der einschlägigen Werbung genannten Eigenschaften entspricht. … Nach Art. 2 Nr. 12 der Richtlinie (EU) 2019/771 bezeichnet im Sinne dieser Richtlinie der Ausdruck "gewerbliche Garantie" jede dem Verbraucher gegenüber zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eingegangene Verpflichtung des Verkäufers oder eines Herstellers (Garantiegebers), den Kaufpreis zu erstatten oder die Waren zu ersetzen, nachzubessern oder in sonstiger Weise Abhilfe zu schaffen, falls sie nicht die Eigenschaften aufweisen oder andere nicht mit der Vertragsmäßigkeit verbundene Anforderungen erfüllen sollten, die in der Garantieerklärung oder der einschlägigen Werbung, wie sie bei oder vor Abschluss des Vertrags verfügbar war, beschrieben sind. …" § 443 BGB und die einschlägigen europäischen Richtlinien gehen also grundsätzlich dann von einer Garantie aus, wenn die Garantieerklärung sich auf objektive Eigenschaften der Kaufsache wie Mängel, fehlende Vertragsgemäßheit, Zustand oder bestimmte Merkmale bezieht. Fraglich ist, ob auch dann eine Garantie i.S.d. Vorschriften vorliegt, wenn die Garantieerklärung nur auf die subjektive Zufriedenheit des Käufers abstellt (BGH a.a.O, Rz. 34 ff.): "c) Ebenso wie das Berufungsgericht hat der Senat keinen Zweifel daran, dass bei richtlinienkonformer Auslegung des § 443 Abs. 1 BGB die Zufriedenheit des Verbrauchers mit dem erworbenen Produkt keine einer Garantie zugängliche Beschaffenheit der Kaufsache im Sinne von § 443 Abs. 1 Fall 1 BGB darstellt. … Nach diesen Kriterien stellt die Zufriedenheit des Käufers mit dem erworbenen Produkt keine die Mängelfreiheit betreffende Beschaffenheit der Kaufsache dar. Seine Zufriedenheit kann zwar an den Zustand oder die Merkmale der Kaufsache anknüpfen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, denen die Revisionserwiderung nicht entgegengetreten ist und die auch keinen Rechtsfehler erkennen lassen, kann der Käufer nach der "L. Warranty" das Produkt aber auch zurückgeben, wenn sich seine Unzufriedenheit nicht auf objektive Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Kaufsache gründet und keinen Bezug zu Mängeln aufweist, sondern er die Kaufsache aus in seiner Person liegenden subjektiven Gründen missbilligt. bb) Aus dem Begriff der Eigenschaften in Art. 1 Abs. 2 Buchst. e der Richtlinie 1999/44/EG und in Art. 2 Nr. 12 der Richtlinie (EU) 2019/771 ergibt sich nach Ansicht des Senats nichts Anderes. Anders als der Revisionserwiderung er- scheint es ihm nicht zweifelhaft, dass danach nur solche Umstände eine garan- tiebegründende Eigenschaft des Verbrauchsguts beziehungsweise der Ware darstellen, die einen objektiven Bezug zu ihr aufweisen, und subjektive Anforde- rungen des Verbrauchers an die als solche vertragsgemäße Kaufsache nicht ausreichen. … cc) Es erscheint nicht zweifelsfrei, ob die Zufriedenheit des Verbrauchers mit der Kaufsache eine Anforderung in diesem Sinne darstellt. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Erklärung der Beklagten die Zusage enthalte, der Käufer dürfe im Fall seiner Unzufriedenheit mit dem erworbenen Produkt es zurückgeben, ohne dass er nachvollziehbar begründen müsse, warum es seinen Vorstellungen nicht entspreche. Die Rücknahmepflicht der Beklagten entstehe demnach unabhängig von den objektiven Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Kaufsache. Diese tatgerichtliche Beurteilung wird von den Parteien nicht beanstandet, Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar. Danach stellt sich die Frage, ob eine andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderung im Sinne von Art. 2 Nr. 14 der Richtlinie 2011/83/EU und eine andere nicht mit der Vertragsmäßigkeit verbundene Anforderung im Sinne von Art. 2 Nr. 12 der Richtlinie (EU) 2019/771 vorliegen kann, wenn die Verpflichtung des Garantiegebers an in der Person des Verbrauchers liegende Umstände, ins- besondere an seine subjektive Haltung zur Kaufsache (hier: die in das Belieben des Verbrauchers gestellte Zufriedenheit mit der Kaufsache) anknüpft, ohne dass diese persönlichen Umstände mit dem Zustand oder den Merkmalen der Kaufsache zusammenhängen müssen. …"
Every L. product comes with our own lifetime guarantee. If you are not com- pletely satisfied with any of our products, please return it to your specialist dealer from whom you purchased it. Alternatively, you can return it to "L. " directly but remember to tell us where and when you bought it."
Die Kanzlei Gutsch & Schlegel aus Hamburg mahnt erneut Medienhändler und Online-Antiquariate/recommerce-Anbieter wegen des Verkaufs sogenannter Bootlegs (nicht lizenzierte Aufnahmen, meist Mitschnitte von Live-Aufnahmen) ab, diesmal / zur Zeit vermehrt für Mark Knopfler (Dire Straits). Gutsch & Schlegel macht Ansprüche auf Unterlassen und Vernichtung, Auskunft und Schadensersatz sowie Kostenersatz (Kosten für die Abmahnung) geltend. Es lohnt sich, diese Abmahnungen genau zu prüfen/prüfen zu lassen und keine vorschnellen Zugeständnisse zu machen. Grundsätzlich muss der (angebliche) Rechteinhaber / Gutsch & Schlegel den behaupteten Rechtsverstoß (Bootlegs, Piracy, Grau-/Parallelimport, etc.) nachweisen und dazu insb. die Rechteinhaberschaft und Anspruchsberechtigung lückenlos über die gesamte Rechtekette nachweisen. ... mehr Auch in Bezug auf die geltend gemachte Erstattung der Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzforderungen lohnt ein genauer Blick. Insbesondere ist die außergerichtliche Inanspruchnahme mehrerer Schädiger nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebührenrechtlich i.d.R. als eine Angelegenheit anzusehen, wodurch nur ein Bruchteil der von Gutsch & Schlegl regelmäßig eingeforderten Gebühren erstattet werden muss (Urteil BGH – Der Novembermann). Kosten für die Ermittlung der angeblichen Rechtsverletzung durch die GUMPS GmbH (Geschäftsführer sind auch hier die Rechtsanwälte Gutsch und Schlegel)sind i.d.R. ebenfalls nicht geschuldet, und wurden von den Gerichten bereits in mehreren Verfahren zurückgewiesen. Uns liegen zur Zeit Abmahnungen von Mark Knopfler (Dire Straits) für folgen (angebliche) Bootlegs vor: RAe Gutsch & Schlegel gehen zudem auch wegen angeblicher Bootleg-Aufnahmen der Musiker/Musikgruppen u.a. gegen Medienhändler, Online-Antiquariate und Gebraucht-Medien-Händler (recommerce), sowie gegen private Anbieter (eBay-Verkäufe), vor. In den meisten Fällen konnten wir erreichen, dass gegen unsere Mandanten keine Klagen eingereicht wurden und Kosten und Schadensersatzforderungen außergerichtlich abwehren. Zudem konnten wir Klagen meist erfolgreich abwehren, u.a. Klagen betreffend die Musikgruppen/Musiker Iron Maiden, Genesis, Phil Collin; Klagen der Kanzlei Gutsch & Schlegel wurden in diesen Fällen abgewiesen (Amts- und Landgericht Hamburg).
Mit Urteil vom 16.12.2021, Az. 15 U 160/20, hat das OLG Hamburg eine Irreführung i.S.d. Wettbewerbsrechts (UGP-Richtlinie) durch ein mehrsprachiges, grenzüberschreitendes Online-Angebot (Vermittlung von Ferienwohnungen) verneint: ... mehr "Gemäß Art. 7 Abs. 2 letzter Hs. der UGP-Richtlinie muss die Unklarheit bzw. Unverständlichkeit einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlassen oder zu veranlassen geeignet sein, die er ansonsten nicht getroffen hätte (geschäftliche Relevanz). Zwar wird in Art. 6 Abs. 3 des polnischen UWG (sowohl in der deutschen Übersetzung gemäß Anlage K7 als auch in der englischen Übersetzung gemäß Anlage B7) die geschäftliche Relevanz nur bei der dortigen Nr. 2) und nicht auch in der hier einschlägigen Nr. 1) erwähnt. Sofern dies jedoch so zu verstehen sein sollte, dass die Norm die geschäftliche Relevanz nur in Nr. 2) fordert, wäre dies angesichts der eindeutigen Regelung in Art. 7 Abs. 2 UGP-Richtlinie gemeinschaftsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass die geschäftliche Relevanz auch nach der dortigen Nr. 1) erforderlich ist.
Zwar wird eine Irreführung über zentral bedeutsame Merkmale der angebotenen Waren oder Leistungen in aller Regel geeignet sein, die Kaufentscheidung zu beeinflussen. In solchen Fällen entspricht der Anteil derjenigen Verbraucher, die einer Fehlvorstellung erliegen, dem Anteil der relevant Irregeführten. Dann kann aus der Feststellung der Irreführung eines erheblichen Teils der Verbraucher i.d.R. geschlossen werden, dass eine Werbeangabe geschäftlich relevant ist, so dass es keiner gesonderten Beweiserhebung über die Relevanz irreführender Vorstellungen bedarf (so zu § 5 UWG Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Auflage 2021, § 5 Rn. 1.182 mit Verweis auf BGH GRUR 1991, 215 – Emilio Adani I; BGH GRUR 1991, 852 (855) – Aquavit; BGH GRUR 1993, 920 – Emilio Adani II). Auch in der Kommentierung zu § 5a UWG wird das ähnlich gesehen. Danach ist im Regelfall anzunehmen, dass der durchschnittliche Verbraucher voraussichtlich eine andere geschäftliche Entscheidung getroffen hätte, wenn er über die betreffende Information verfügt hätte, insb. soweit es die wesentlichen Merkmale oder den Preis der Ware oder Dienstleistung betrifft. Jedoch kann es Ausnahmefälle geben, in denen die geschäftliche Relevanz zu verneinen ist. Für das Vorliegen eines Ausnahmefalls trägt der Unternehmer die sekundäre Darlegungslast (Köhler in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 39. Auflage 2021, § 5a Rn. 3.44 mit Verweis auf BGH WRP 2017, 1081 Rn. 32 – Komplettküchen; BGH WRP 2018, 420 Rn. 25 – Kraftfahrzeugwerbung; BGH WRP 2019, 874 Rn. 28 – Energieeffizienzklasse III; OLG Frankfurt WRP 2018, 241 Rn. 25; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2019, 166 Rn. 44; krit. Büscher WRP 2019, 1249 Rn. 19 ff.). Hier geht es indes unstreitig nicht um eine „klassische" Irreführung im Sinne einer Fehlvorstellung und auch nicht um das vollständige Vorenthalten von Informationen, sondern um das Bereitstellen von Informationen auf unklare oder unverständliche Weise i.S.v. Art. 7 Abs. 2 der UGP-Richtlinie dadurch, dass diese nicht auf Polnisch, sondern auf Englisch gegeben werden. Damit liegt ein Ausnahmefall vor. Denn es ist gerade nicht ohne weiteres ersichtlich, zu welcher geschäftlichen Entscheidung der Verbraucher veranlasst werden könnte (1. Stufe der geschäftlichen Relevanz) – und vor allem nicht, dass er diese nicht getroffen hätte, wenn er die fraglichen Informationen auf Polnisch erhalten hätte (2. Stufe der geschäftlichen Relevanz).
Das Landgericht hat zutreffend angenommen, der Verbraucher werde keinen Mietvertrag über eine Ferienimmobilie abschließen, wenn er die Angaben in einer ihm fremden Sprache nicht versteht, und damit schon die 1. Stufe der geschäftlichen Relevanz verneint. …
Soweit der Kläger geltend macht, dass Merkmale einer Ferienimmobilie wie Raumzuschnitt, Ausstattung und Lage für den Verbraucher entscheidend seien, ist dem zuzustimmen. Dann aber wird der Verbraucher, wenn er die Angaben dazu nicht versteht, mangels Kenntnis der für ihn wesentlichen Informationen keine geschäftliche Entscheidung im Sinne eines Vertragsschlusses treffen, so dass es bereits an der 1. Stufe der geschäftlichen Relevanz fehlt. …"
Mit Urteil vom 24. Februar 2022 (Az. I ZR 2/21) hat der Bundesgerichtshof zur Werbung für sog. "Tribute-Shows" entschieden. Streitgegenständlich war eine Show über und mit den größten Hits der bekannten Sängerin Tina Turner, die sich – letztlich erfolglos – gegen die Nutzung ihres Namens und Abbildes (dargestellt durch eine andere Sängerin) gewandt hatte: ... mehr Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle Nr. 024/2022 vom 24.02.2022 Die Werbung für eine "Tribute-Show" darf nicht den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass das Urteil vom 24. Februar 2022 – I ZR 2/21 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat über die Frage entschieden, unter welchen Voraussetzungen für eine Show, in der die Lieder einer weltberühmten Sängerin nachgesungen werden, mit dem Namen der Sängerin und der Abbildung einer in der Show auftretenden Doppelgängerin geworben werden darf. Sachverhalt: Die unter dem Künstlernamen Tina Turner auftretende Klägerin ist eine weltberühmte Sängerin. Die Beklagte ist die Produzentin einer Show, in der die Sängerin F. auftritt und die größten Hits der Klägerin präsentiert. Die Beklagte warb mit Plakaten, auf denen F. abgebildet und die Show mit den Worten "SIMPLY THE BEST – DIE tina turner STORY" angekündigt wird. Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Betrachter aufgrund der Ähnlichkeit zwischen F. und ihr sowie des genannten Texts davon ausgehe, sie selbst sei auf den Plakaten abgebildet und an der Show beteiligt. Die Klägerin hatte weder in die Verwendung ihres Bildnisses noch ihres Namens eingewilligt und nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Bisheriger Prozessverlauf: Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, der Klägerin stünden keine Unterlassungsansprüche zu. Mit der vom Oberlandesgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Beklagte in den vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt des Rechts am eigenen Bild und am eigenen Namen der Klägerin eingegriffen hat. Wird eine Person durch eine andere Person – beispielsweise einen Schauspieler – dargestellt, liegt ein Eingriff in das Recht am eigenen Bild vor, wenn aus Sicht eines nicht unerheblichen Teils des angesprochenen Publikums der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die dargestellte Person selbst. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die beanstandete Werbung den Eindruck erweckt, auf den Plakaten sei die Klägerin abgebildet. Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht die Verwendung des Bildnisses der Klägerin auf den streitgegenständlichen Plakaten der Beklagten als nach §§ 22, 23 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Kunsturhebergesetz (KUG) erlaubt angesehen. Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG bereits deswegen nicht zu Gunsten der Beklagten eingreifen könne, weil das in Rede stehende Bildnis auf Bestellung angefertigt worden sei. Ist die tatsächlich abgebildete Person nicht identisch mit der Person, die aus Sicht eines nicht unerheblichen Teils des angesprochenen Publikums (vermeintlich) abgebildet ist, kann allenfalls die tatsächlich, nicht aber die vermeintlich abgebildete Person gegen die Verwendung der Abbildung einwenden, dass sie auf Bestellung angefertigt worden sei. Der Anwendung des § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte ein Bildnis der Klägerin zur Bewerbung einer anderen Kunstform – hier einer Tribute-Show – eingesetzt hat. Vor dem Hintergrund des weiten Schutzbereichs der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG ist dies vom Anwendungsbereich der Vorschrift erfasst. Die Werbung für eine Show, in der Lieder einer prominenten Sängerin von einer ihr täuschend ähnlich sehenden Darstellerin nachgesungen werden, mit einem Bildnis der Darstellerin, das den täuschend echten Eindruck erweckt, es handele sich um die prominente Sängerin selbst, ist grundsätzlich von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein nicht gerechtfertigter Eingriff in den vermögenswerten Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des prominenten Originals ist mit der Werbung für eine solche Tribute-Show allerdings dann verbunden, wenn der unzutreffende Eindruck erweckt wird, das prominente Original unterstütze sie oder wirke sogar an ihr mit. Das Berufungsgericht ist zu dem zutreffenden Ergebnis gelangt, dass den Plakaten der Beklagten nicht die unwahre Tatsachenbehauptung zu entnehmen ist, die Klägerin unterstütze die Show der Beklagten oder wirke sogar an ihr mit. Die Plakate enthalten keine ausdrückliche Aussage darüber und sind auch nicht in diesem Sinne mehrdeutig. Für die Interessenabwägung zum Recht der Klägerin am eigenen Namen hat das Berufungsgericht auf seine Ausführungen bei der Interessenabwägung zum Recht am eigenen Bild verwiesen. Dies ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Vorinstanzen: LG Köln – Urteil vom 22. Januar 2020 – 28 O 193/19 OLG Köln – Urteil vom 17. Dezember 2020 – 15 U 37/20 Die maßgeblichen Vorschriften lauten: § 22 Satz 1 KUG Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 4 und Abs. 2 KUG (1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden: 1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; (…) 4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient; (…) (2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
prominente Original die Show unterstützt oder sogar an ihr mitwirkt
Mit Versäumnisurteil vom 19.01.2022 (Az. 2-13 O 60/21) hat das LG Frankfurt a.M. klargestellt, dass seit Geltung der aktiven Nutzungspflicht des "besonderen elektronischen Anwaltspostfachs" (beA) am 1. Januar 2022, Schriftsätze grundsätzlich nur noch als elektronische Dokumenten eingereicht werden können. Schriftsätze, die per Post oder per Fax eingereicht werden, sind formunwirksam und unbeachtlich: ... mehr "… Der Beklagte war auf Antrag des Klägers im schriftlichen Vorverfahren gemäß § 331 Abs. 3 S. 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung durch Versäumnisurteil zu verurteilen. Obschon ordnungsgemäß gemäß § 276 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 ZPO belehrt, hat der Beklagte seine Verteidigungsbereitschaft nicht fristgerecht angezeigt. Die Verteidigungsanzeige hätte gemäß § 130d S. 1 ZPO als elektronisches Dokument übermittelt werden müssen. Weder das auf dem Postweg eingereichte handschriftlich unterschriebene Anwaltsschreiben noch dessen Faxkopie wahren die seit dem 01.01.2022 zwingend vorgeschriebene Form; sie sind daher unbeachtlich. Seit dem 01.01.2022 sind gemäß § 130d S. 1 ZPO vorbereitende Schriftsätze sowie schriftlich einzureichenden Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden, als elektronisches Dokument zu übermitteln. Dabei gilt § 130d S. 1 ZPO grundsätzlich für alle anwaltlichen schriftlichen Anträge und Erklärungen nach der ZPO (BT-Drs. 17/12634, 28). Zu den von der Vorschrift umfassten Erklärungen gehört auch die Verteidigungsanzeige im schriftlichen Vorverfahren, die nach § 276 Abs. 1 S. 1 ZPO schriftlich anzuzeigen ist. Der von § 130d ZPO vorgegebene Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO – in der Regel die Einreichung über das besondere Anwaltspostfach (beA) – ist nach dem 01.01.2022 der einzig zulässige (Greger in: Zöller, Zivilprozessordnung, 34. Aufl. 2022, § 130d ZPO, Rn. 1). Eine Ausnahme, wonach die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig ist, besteht nach den § 130d S. 2 ZPO allein für den Fall, dass die Einreichung auf dem Weg des § 130a ZPO aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesen Fällen ist die vorübergehende Unmöglichkeit nach § 130d S. 3 ZPO jedoch bei Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen. Dies ist hier nicht geschehen, weder zusammen mit der Ersatzeinreichung noch unverzüglich danach; seit der Ersatzeinreichung sind zwei Wochen ohne weitere Erklärung vergangen. Die Form der Einreichung ist eine Frage der Zulässigkeit und von Amts wegen zu beachten. Auf die Einhaltung der Vorgaben des § 130d ZPO können die Parteien nicht verzichten (§ 295 ZPO), der Gegner kann sich auch nicht rügelos einlassen (BT-Drs. 17/12634, 27). Die Einschränkung auf die Übermittlung als elektronisches Dokument hat zur Folge, dass auf anderem Wege eingereichte Klagen oder Berufungen als unzulässig abzuweisen bzw. zu verwerfen sind (BT-Drs. 17/12634, 27; Greger in: Zöller, Zivilprozessordnung, 34. Aufl. 2022, § 130d ZPO, Rn. 1; Siegmund NJW 2021, 3617 (3618); BeckRA-HdB, § 69 Rn. 54; zur Parallelvorschrift des § 46 g ArbGG siehe LAG Schleswig-Holstein Beschl. v. 25.3.2020 – 6 Sa 102/20, BeckRS 2020, 10446). Prozesserklärungen sind unwirksam und Fristen werden durch sie nicht gewahrt (Fritsche NZFam 2022, 1 (1); Hoeren/Sieber/Holznagel MMR-HdB, Teil 24 Digitale Justiz Rn. 11). Diese Rechtsfolge entspricht dem klaren Willen des Gesetzgebers (BT-Drs. 17/12634, 27) und ist auch sachgerecht. Denn ohne diese Rechtsfolgenbewehrung könnte die Pflicht zur flächendeckenden Aktivnutzung des beA nicht wirksam etabliert werden. Mithin ist auch eine auf anderem als auf dem elektronischen Übermittlungsweg nach § 130d S. 1 ZPO eingereichte Verteidigungsanzeige unbeachtlich. …" Ebenso hat jetzt auch das LG Köln entscheiden, Urteil vom 22.02.2022, Az. 14 O 395/21: "Der Einspruch war zu verwerfen, weil er nicht in der gesetzlichen Form eingelegt worden ist (§ 341 ZPO). Der Einspruch wird gemäß § 340 Abs. 1 ZPO durch Einreichung der Einspruchsschrift bei dem Prozessgericht eingelegt. Seit Beginn des Jahres 2022 gilt § 130d ZPO, wonach "vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt […] eingereicht werden, als elektronisches Dokument zu übermitteln" sind. Insoweit ergeben sich die Einzelheiten aus § 130a ZPO. Auch die Einspruchsschrift nach einem Versäumnisurteil fällt als bestimmender Schriftsatz unter die Pflicht nach §§ 130a, 130d ZPO Vorliegend ist der Einspruch vom 13.01.2022 durch die Prozessbevollmächtigte des Klägers lediglich per Fax am 14.01.2022 beim Landgericht Köln eingegangen. Dies genügt nicht den Anforderungen der §§ 130a, 130d ZPO. Die Einspruchsschrift ist auch nach dem Faxeingang nicht als elektronisches Dokument übermittelt worden. Auch nach Hinweis des Gerichts vom 28.01.2022 auf diesen Umstand ist die Einspruchsschrift nicht als elektronisches Dokument übermittelt worden. Eine Unmöglichkeit der Übermittlung als elektronisches Dokument nach § 130d S. 2 ZPO ist nicht dargelegt worden. Die Erhebung des Einspruchs per Fax als Prozesshandlung ist folglich unwirksam und nicht zu beachten. Angesichts des Zeitablaufs seit Zustellung des Versäumnisurteils war der formnichtige Einspruch zu verwerfen."
Mit Urteil vom 28. Oktober 2021, Az. 6 U 147/20 hat das OLG Frankfurt am.M. ausführlich dargelegt, wie etwaige Schadensersatzansprüche in Fällen von Wettbewerbsverstößen zu berechnen sind. ... mehr Grundsätzlich kann ein Schadensersatzanspruch im Bereich des geistigen Eigentums (Urheberrecht, Markenrecht, sonst. gewerbliche Schutzrechte) auf drei unterschiedliche Weisen berechnet werden, nämlich als konkreter Schaden (einschl. ggf. eines entgangene Gewinns, § 252 S. 2 BGB), im Wege der Lizenzanalogie, und als Gewinnabschöpfung (vgl. z.B. § 97 Abs. 2 UrhG). Bei Verstößen gegen die Regeln des lauteren Wettbewerbs gilt dies allerdings nur mit Einschränkungen, nämlich bei Verstößen gegen §§ 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 3 oder Nr. 4 UWG, also bei unlauteren Produktnachahmungen (sog. lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz) und bei unlauteren Wettbewerber-Behinderungen. Gewinnabschöpfung kann nach § 10 Abs. 1 UWG n.F. zudem nicht von Wettbewerbern geltend gemacht werden, sondern nur von Wettbewerbsverbänden u.ä.: "a) Die von der Rechtsprechung entwickelte sog. dreifache Schadensberechnung ist, soweit es die Rechte des geistigen Eigentums betrifft, durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004 einheitlich geregelt worden (dazu BGH GRUR 2010, 1091 Rn 18 – Werbung eines Nachrichtensenders; Meier-Beck WRP 2012, 503). Danach kann bei der Bemessung des Schadensersatzes auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann ferner auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des Rechts eingeholt hätte, oder auf der Grundlage des entgangenen eigenen Gewinns. Diese Grundsätze sind nicht nur bei Schutzrechten, sondern – allerdings mit Einschränkungen – auch im Lauterkeitsrecht anwendbar. Die dreifache Schadensberechnung ist insoweit anerkannt bei Schadensersatzansprüchen wegen Verletzung der nach § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 3 und Nr. 4 geschützten Leistungen (BGH GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion "Holiday"; BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität; BGH GRUR 2007, 431 Rn 21 – Steckverbindergehäuse; BGH WRP 2017, 51 Rn 79 – Segmentstruktur). Eine Anwendung der Grundsätze der dreifachen Schadensberechnung auf sonstige Wettbewerbsverstöße (z.B. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 1 und 2 UWG) kommt dagegen in der Regel nicht in Betracht. Denn insoweit weist das Lauterkeitsrecht dem Mitbewerber keine dem Schutz der Leistung vergleichbare schützenswerte Marktposition zu (Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler UWG, 39. Aufl. 2021, § 9 Rn 1.36b; a.A. Ohly GRUR 2007, 926, 927 f.)." Entscheidet sich die_der Geschädigte für die die Schadensberechnung des "entgangene Gewinns", oder steht nur diese Berechnungsmethode zur Verfügung, so muss er_sie seine_ihren entgangenen Gewinn schlüssig darlegen und dazu i.d.R. seine_ihre interne Kalkulation offen legen: "Zwar ist nachvollziehbar, dass die Klägerin ihre internen Kalkulationsdaten nicht offenlegen will. Dies ist jedoch zwingend erforderlich, wenn die Klägerin darlegen will, dass ihr durch das Verhalten der Beklagten ein bestimmter eigener Gewinn entgangen sei. Der Geschädigte darf sich nicht auf allgemeine Darlegungen zum mutmaßlichen Gewinn beschränken, sondern er muss produktbezogene Ausführungen machen, um dem Gericht eine Schadensschätzung zu ermöglichen. Er ist gehalten, die Kalkulation für seine Ware zu offenbaren (Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 14 MarkenG Rn 464) und muss insbesondere Erlöse und produktbezogene Kosten einander gegenüberstellen (BGH GRUR 1980, 841, 842 f. – Tolbutamid; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday; OLG Köln GRUR-RR 2014, 329; BeckOK MarkenR/Goldmann, 26. Ed. 1.7.2021, MarkenG § 14 Rn 750.3). Vor diesem Hintergrund ist der Vortrag der Klägerin unzureichend, da sie lediglich eine allgemeine Gewinnspanne vorgetragen hat. Sie hätte zumindest die Gewinnspanne unter Darlegung der genannten Einzelheiten (Erlöse und Kosten) – bezogen auf die beanstandeten Modelle bzw. auf ihre mit diesen vergleichbaren Modellen – vortragen müssen." Es reicht dann auch nicht aus, die Kalkulation hinter einer "Gutachtenwand" zu verstecken: "Der Versuch der Klägerin, die Kalkulationsparameter hinter einer "Gutachtenwand" zu verstecken, indem sie einem Privatgutachter diese zugänglich gemacht hat, diese aber nicht in das Gutachten Eingang gefunden haben, ist daher nicht erfolgreich. Soweit die Klägerin dem in der mündlichen Verhandlung entgegengehalten hat, §§ 252 BGB, 287 ZPO entbinde sie insoweit von der Darlegung der Kalkulationsgrundlagen und sie weiterhin ein Sachverständigengutachten angeboten hat, kann dies zu keinem anderen Ergebnis führen. Die Bestimmung des § 252 S. 2 BGB, nach welcher der Gewinn als entgangen gilt, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, und die Vorschrift des § 287 ZPO, nach der das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung darüber entscheidet, wie hoch sich ein unter den Parteien streitiger Schaden beläuft, entheben den Verletzten zwar der Notwendigkeit, den entgangenen Gewinn genau zu belegen. Sie ersparen es ihm jedoch nicht, dem Gericht eine tatsächliche Grundlage zu unterbreiten, die diesem eine wenigstens im Groben zutreffende Schätzung des entgangenen Gewinns ermöglicht (BGH GRUR 2016, 860 Rn 20, 21 – Deltmethrin II). Auf solche konkreten Anhaltspunkte kann nicht verzichtet werden, da der Schädiger sonst im Einzelfall der Gefahr einer willkürlichen Festsetzung der von ihm zu erbringenden Ersatzleistung ausgesetzt wäre. Bei aller Anerkennung des häufig bestehenden Beweisnotstandes des Geschädigten wäre dies mit dem Sinn und Zweck der §§ 287 ZPO, 252 BGB nicht zu vereinbaren." Zudem muss der_die Geschädigte den Kausalzusammenhang zwischen der ihn_sie schädigenden, wettbewerbswidrigen Handlung des_der Verletzers_in, und seinem_ihren Schaden darlegen: "Dem Verletzten obliegt es, die Kausalität zwischen der Verletzung und dem ihm entgangenen Gewinn nachzuweisen. Die Befugnis zur Schätzung der Höhe des Gewinns schließt auch alle Kausalitäts- und Zurechnungsfragen mit ein (Goldmann WRP 2011, 950, 953). Für den Nachweis eines Schadens bestehen in der Natur der Sache liegende Beweisschwierigkeiten, vor allem was die künftige Entwicklung des Geschäftsverlaufs betrifft. In dem vorliegenden besonderen Fall ist nicht hinreichend dargelegt, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ein Gewinn mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. …" Gelingt dies – wie im Fall des OLG Frankfurt – nicht, so besteht ein Anspruch auf Schadensersatz.
Erneut hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 01. Dezember 2021 (1 BvR 2708/19) einem presserechtlichen Verfahren festgestellt, dass es des grundrechtsgleiche Recht auf prozessuale Waffengleichheit gemäß Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz der Antragsgegnerin verletzt, wenn ein Gericht eine einstweilige Anordnung ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin ("… der Dringlichkeit wegen ohne mündliche Verhandlung …") erlässt. … mehr Im zugrundeliegenden Verfahren geht es um die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen in einer äußerungsrechtlichen Sache. Das Oberlandesgericht hatte ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin eine einstweilige Anordnung erlassen, nachdem es zuvor mehrere gerichtliche Hinweise an die Antragstellerin erteilt hatte, infolge derer diese ihre Anträge umgestellt, ergänzt und teilweise zurückgenommen hatte. Die Antragsgegnerin war darüber nicht informiert, noch sonst angehört worden. Der Beschluss des Oberlandesgerichts verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG: "aa) Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit ist Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit und des allgemeinen Gleichheitssatzes im Zivilprozess und sichert verfassungsrechtlich die Gleichwertigkeit der prozessualen Stellung der Parteien vor Gericht. Das Gericht muss den Prozessparteien im Rahmen der Verfahrensordnung gleichermaßen die Möglichkeit einräumen, alles für die gerichtliche Entscheidung Erhebliche vorzutragen und alle zur Abwehr des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen Verteidigungsmittel selbständig geltend zu machen. Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus Art. 103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist. Als prozessuales Urrecht (vgl. BVerfGE 70, 180 <188>) gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen (vgl. BVerfGE 9, 89 <96>; 57, 346 <359>). Entbehrlich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen. Voraussetzung der Verweisung auf eine nachträgliche Anhörung ist, dass ansonsten der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens vereitelt würde (vgl. näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17 -, Rn. 15). Im Presse- und Äußerungsrecht kann von einer Erforderlichkeit der Überraschung des Gegners bei der Geltendmachung von Ansprüchen jedenfalls nicht als Regel ausgegangen werden (vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 2421/17 -, Rn. 31). bb) Auch wenn über Verfügungsanträge in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten angesichts der Eilbedürftigkeit nicht selten zunächst ohne mündliche Verhandlung entschieden werden muss, berechtigt dies das Gericht nicht dazu, die Gegenseite bis zur Entscheidung über den Verfügungsantrag aus dem Verfahren herauszuhalten (vgl. näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17 -, Rn. 21 bis 24). Eine stattgebende Entscheidung über den Verfügungsantrag kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag und weiteren an das Gericht gerichteten Schriftsätzen geltend gemachte Vorbringen zu erwidern. Dabei ist von Verfassungs wegen nichts dagegen einzuwenden, wenn das Gericht in solchen Eilverfahren auch die Möglichkeiten einbezieht, die es der Gegenseite vorprozessual erlauben, sich zu dem Verfügungsantrag zu äußern, wenn sichergestellt ist, dass solche Äußerungen vollständig dem Gericht vorliegen. Insoweit kann auf die Möglichkeit zur Erwiderung gegenüber einer dem Verfügungsverfahren vorangehenden Abmahnung abgestellt werden. Dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit genügen die Erwiderungsmöglichkeiten auf eine Abmahnung allerdings nur dann, wenn der Verfügungsantrag in Anschluss an die Abmahnung unverzüglich nach Ablauf einer angemessenen Frist für die begehrte Unterlassungserklärung bei Gericht eingereicht wird, die abgemahnte Äußerung sowie die Begründung für die begehrte Unterlassung mit dem bei Gericht geltend gemachten Unterlassungsbegehren identisch sind und der Antragsteller ein etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner Antragsschrift bei Gericht eingereicht hat. Nur dann ist sichergestellt, dass der Antragsgegner hinreichend Gelegenheit hatte, sich zu dem vor Gericht geltend gemachten Vorbringen des Antragstellers in gebotenem Umfang zu äußern. Demgegenüber ist dem Antragsteller Gehör zu gewähren, wenn er nicht in der gehörigen Form abgemahnt wurde oder der Antrag vor Gericht in anderer Weise als in der Abmahnung oder mit ergänzendem Vortrag begründet wird (vgl. näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17 -, Rn. 22 bis 24; sowie Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten Senats vom 3. Juni 2020 – 1 BvR 1246/20 -, Rn. 18 f.; vom 17. Juni 2020 – 1 BvR 1380/20 -, Rn. 14 und vom 22. Dezember 2020 – 1 BvR 2740/20 -, Rn. 22). Gehör ist insbesondere auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 ZPO erteilt, von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung erfährt (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17 -, Rn. 24; siehe auch BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten Senats vom 27. Juli 2020 – 1 BvR 1379/20 -, Rn. 16 und vom 22. Dezember 2020 – 1 BvR 2740/20 -, Rn. 23). Entsprechend ist es verfassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Gegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, indem auch ihm die richterlichen Hinweise zeitnah mitgeteilt werden. Dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsauskünften in Hinweisform darum geht, einen Antrag gleichsam nachzubessern oder eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten abzugeben. Ein einseitiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über Rechtsfragen austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfahrensgrundsätzen des Grundgesetzes unvereinbar (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17 -, Rn. 24; Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten Senats vom 3. Juni 2020 – 1 BvR 1246/20 – Rn. 19; vom 22. Dezember 2020 – 1 BvR 2740/20 -, Rn. 23 und vom 11. Januar 2021 – 1 BvR 2681/20 -, Rn. 33)." "Nach diesen Maßstäben verletzt der angegriffene Beschluss die Beschwerdeführerin offenkundig in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit. Durch den Erlass der einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin war vorliegend keine Gleichwertigkeit ihrer prozessualen Stellung gegenüber dem Verfahrensgegner gewährleistet. Zwar hatte die Antragstellerin die Beschwerdeführerin vorprozessual abgemahnt. Der Verfügungsantrag, dem der Pressesenat stattgab, entsprach jedoch nicht mehr der außerprozessualen Abmahnung. Er war durch die Aufnahme der „Eindrucksvariante" wesentlich verändert worden. Nach den Grundsätzen der prozessualen Waffengleichheit müssen sich die Parteien eines gerichtlichen Streits gleichermaßen zu den wesentlichen Argumenten und zum Streitstoff verhalten können. Wird ein neues Argument in den Rechtstreit eingeführt – wie die erstmalige Berufung auf einen bestimmten ehrabschneidenden Eindruck –, verändert sich dadurch die Streitlage, auch wenn es noch um denselben Lebenssachverhalt geht. Hier waren mehrere gerichtliche Hinweise an die Antragstellerin ergangen, infolge derer sie ihre Anträge umgestellt, ergänzt und teilweise zurückgenommen hatte. Während die Antragstellerin somit mehrfach und flexibel nachsteuern konnte, um ein für sie positives Ergebnis des Verfahrens zu erreichen, hatte die Beschwerdeführerin keinerlei Möglichkeit, auf die veränderte Sach- und Streitlage zu reagieren. Sie wusste bis zur Zustellung der Entscheidung des Pressesenats nicht, dass gegen sie ein Verfahren geführt wurde. Dies verletzt die prozessuale Waffengleichheit. Spätestens das Oberlandesgericht hätte die Beschwerdeführerin vor dem Erlass seines Beschlusses über die zuvor an die Antragstellerin ergangenen Hinweise in Kenntnis setzen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu den veränderten Anträgen geben müssen. Die Einbeziehung der Beschwerdeführerin durch das Gericht vor Erlass der einstweiligen Verfügung war offensichtlich geboten. Eine Frist zur Stellungnahme hätte durchaus kurz bemessen sein können. Unzulässig ist es jedoch, wegen einer gegebenenfalls durch die Anhörung des Antragsgegners befürchteten Verzögerung oder wegen einer durch die Stellungnahme erforderlichen, arbeitsintensiven Auseinandersetzung mit dem Vortrag des Antragsgegners bereits in einem frühen Verfahrensstadium gänzlich von einer Einbeziehung der Gegenseite abzusehen und sie stattdessen bis zum Zeitpunkt der auf einen Widerspruch hin anberaumten mündlichen Verhandlung mit einer einseitig erstrittenen gerichtlichen Unterlassungsverfügung zu belasten." "Der wiederholte Verstoß des Pressesenats des Oberlandesgerichts gegen das Gesetz der Waffengleichheit bei einstweiligen Anordnungen gibt Anlass, auf die rechtliche Bindungswirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinzuweisen (§ 31 Abs. 1, § 93 c Abs. 1 Satz 2 BVerfGG, dazu BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 27. Januar 2006 – 1 BvQ 4/06 -, Rn. 26 ff.). Bei zukünftigen Verstößen gegen die Waffengleichheit durch den Senat wird die Kammer ein Feststellungsinteresse für eine Verfassungsbeschwerde oder einen Antrag auf einstweilige Anordnung gemäß § 32 BVerfGG stets als gegeben ansehen."
Das Bundesverfassungsgericht stellte deutlich klar, dass dies die Antragsgegnerin "offenkundig" in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit verletze:
Diesen wiederholten Verstoß eines Fachgerichts gegen das Gebot der Waffengleichheit in einstweiligen Verfügungsverfahren veranlasste das Bundesverfassungsgericht deutlich auf die Bindungswirkung seiner Entscheidungen hinzuweisen:
Die Grundsätze der prozessuale Waffengleichheit gelten nicht nur im Bereich des Presse-/Äußerungsrechts, sondern ebenso im Wettbewerbsrecht und im Bereich des Urheberrechts und gewerblichen Rechtsschutzes.
Mit Beschluss vom 3. Mai. 2021 (Az. 6 W 5/21) hat (soweit ersichtlich: erstmals) das OLG Schleswig die Regeln des jüngst reformierten Wettbewerbsrechts (UWG; im Dezember 2020 in Kraft getreten) angewendet und entschieden, dass es bei Verstößen gegen die in § 13 Abs. 4 UWG n.F. aufgeführten Informationspflichten nach nach § 13a Abs. 2 UWG n.F. ausreicht, wenn der Schuldner eine einfache Unterlassungserklärung ohne Vertragsstrafeversprechen abgibt. Im konkreten Fall ging es um eine falsche Grundpreis-Angabe und eine fehlerhafte Verbraucher-Widerrufsbelehrung in einem ebay-Angebot durch einen Einzelunternehmer ohne Mitarbeiter. ... mehr Das OLG Schleswig stellt dabei fest, dass der Gesetzgeber mit dem Reform-Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs die Erzeugung von Vertragsstrafen und Gebühren ausdrücklich eindämmen und der rechtsmissbräuchliche Anspruchsverfolgung im Wettbewerbsrecht entgegenwirken wollte; zudem sollten die Gerichte entlastet werden. Dem Gläubiger stünden im Wiederholungsfalls aber neben dem gesetzlichen Unterlassungsanspruch dann auch der vertragliche (aber nicht strafbewehrte) Unterlassungsanspruch zu, sodass ein Gericht dann nicht mehr das tatsächlich Vorliegen eines Wettbewerbsverstoßes prüfen müsse, sondern nur noch den Verstoß gegen das vertragliche Unterlassungsversprechen. Zudem handele es sich im Wiederholungsfall bei einem erneuten Verstoß nicht mehr um einen erstmaligen Verstoß, sodass dann eine Vertragsstrafe vereinbart werden könne. Ebenfalls ist nach dem neuen UWG in bestimmten Fällen der Ersatz der Kosten für eine (berechtige) Abmahnung ausgeschlossen. Zudem gilt nunmehr auch im Wettbewerbsrecht (wie u.a. schon im Marken- und Urheberecht, das unberechtigte Abmahnungen einen Kostenersatzanspruch des zu unrecht Abgemahnten auslösen können. Die maßgeblichen Vorschriften des (neuen) UWG (n.F.) lauten: § 13 UWG Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; Haftung (1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. (2) In der Abmahnung muss klar und verständlich angegeben werden: 1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall einer Vertretung zusätzlich Name oder Firma des Vertreters, 2. die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung nach § 8 Absatz 3, 3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungsersatzanspruch geltend gemacht wird und wie sich dieser berechnet, 4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände, 5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz ausgeschlossen ist. (3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. (4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen nach Absatz 3 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 ausgeschlossen bei 1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangenen Verstößen gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten oder 2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundesdatenschutzgesetz durch Unternehmen sowie gewerblich tätige Vereine, sofern sie in der Regel weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. (5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht oder soweit entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend gemacht wird, hat der Abgemahnte gegen den Abmahnenden einen Anspruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen. Der Anspruch nach Satz 1 ist beschränkt auf die Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs, die der Abmahnende geltend macht. Bei einer unberechtigten Abmahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar war. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. § 13a UWG – Vertragsstrafe (1) Bei der Festlegung einer angemessenen Vertragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhandlung, 2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens, 3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten sowie 4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an erfolgten und zukünftigen Verstößen. (2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Absatz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 bei einer erstmaligen Abmahnung bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 ausgeschlossen, wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. (3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 Euro nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. (4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des Abmahnenden eine unangemessen hohe Vertragsstrafe, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe. (5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe noch nicht beziffert wurde, kann der Abgemahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungsstelle nach § 15 anrufen. Das Gleiche gilt, wenn der Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe schuldet. Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage nicht zulässig.
Mit Urteil vom 29.05.2020, Az. V ZR 275/18 hat der Bundesgerichtshof BGH seine bisherige Rechtsprechung zur Erteilung von Hausverboten modifiziert und festgestellt, dass privat betriebene, dem allgemeinen Publikumsverkehr geöffnete Geschäfte (Ladengeschäfte ebenso wie Online-Shops) Hausverbote auch ohne sachlichen Grund erteilen dürfen, also bestimmte Kunden vom Einkauf bzw. der Nutzung des Angebots ausschließen dürfen, wenn die Verweigerung des Zutritts für die davon Betroffenen nicht "in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben" entscheidet oder andere Diskriminierungsverbote (z.B. besondere Diskriminierungsverbote nach §§ 19 ff. AGG; Monopolstellung; strukturelle Überlegenheit) vorliegen, BGH a.a.O., Rz. 4 ff., 13 ff.: ... mehr "Die Beklagte ist … grundsätzlich befugt, gegenüber Besuchern ein Hausverbot auszusprechen. Das Hausrecht beruht auf dem Grundstückseigentum oder -besitz (§§ 858 ff., 903, 1004 BGB) und ermöglicht es seinem Inhaber, in der Regel frei darüber zu entscheiden, wem er Zutritt gestattet und wem er ihn verwehrt (st. Rspr., vgl. etwa Senat, Urteil vom 30. Oktober 2009 – V ZR 253/08, NJW 2010, 534 Rn. 11; Senat, Urteil vom 9. März 2012 – V ZR 115/11, NJW 2012, 1725 Rn. 8 jeweils mwN). In ihm kommt die aus der grundrechtlichen Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) fließende Befugnis des Eigentümers zum Ausdruck, mit der Sache grundsätzlich nach Belieben zu verfahren und andere von der Einwirkung auszuschließen (§ 903 Satz 1 BGB). Darüber hinaus ist das Hausrecht Ausdruck der durch Art. 2 Abs. 1 GG gewährleisteten Privatautonomie, die die Selbstbestimmung des Einzelnen im Rechtsleben schützt. Dazu gehört, dass rechtlich erhebliche Willenserklärungen in der Regel keiner Rechtfertigung bedürfen; das gilt in gleicher Weise für die Entscheidung, ob und in welchem Umfang einem Dritten der Zugang zu einer bestimmten Örtlichkeit gestattet wird (vgl. zum Ganzen Senat, Urteil vom 9. März 2012 – V ZR 115/11, NJW 2012, 1725 Rn. 8). … 3. Eine Einschränkung des Hausrechts der Beklagten dahingehend, dass ein von ihr ausgesprochenes Hausverbot eines sachlichen Grundes bedarf, ergibt sich auch nicht aus den mittelbar in das Zivilrecht einwirkenden Grundrechten, namentlich nicht aus dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können sich – außer durch vertragliche Bindungen und die hier nicht einschlägigen Benachteiligungsverbote aus § 19 AGG – Einschränkungen bei der Ausübung des Hausrechts insbesondere daraus ergeben, dass der Hausrechtsinhaber die Örtlichkeit für den allgemeinen Publikumsverkehr öffnet und dadurch seine Bereitschaft zu erkennen gibt, generell und unter Verzicht auf eine Prüfung im Einzelfall jedem den Zutritt zu gestatten, der sich im Rahmen des üblichen Verhaltens bewegt (vgl. Senat, Urteil vom 20. Januar 2006 – V ZR 134/05, NJW 2006, 1054 Rn. 8 [Flughafen]; Urteil vom 30. Oktober 2009 – V ZR 253/08, NJW 2010, 534 Rn. 13 [Fußballstadion]; Urteil vom 9. März 2012 – V ZR 115/11, NJW 2012, 1725 Rn. 22, 24 [verneinend zu einem Wellnesshotel]; BGH, Urteil vom 3. November 1993 – VIII ZR 106/93, BGHZ 124, 39, 43 [Einkaufsmarkt]; Urteil vom 25. April 1991 – I ZR 283/89, NJW-RR 1991, 1512 [Warenhaus]). Das schließt es zwar auch in solchen Fällen nicht aus, dass der Berechtigte die Befugnis zum Aufenthalt nach außen hin erkennbar an rechtlich zulässige Bedingungen knüpft. Geschieht dies jedoch nicht oder sind die Bedingungen erfüllt, bedarf ein gegenüber einer bestimmten Person ausgesprochenes Verbot, die Örtlichkeit zu betreten, zumindest grundsätzlich eines sachlichen Grundes. In solchen Konstellationen tritt die Privatautonomie (Art. 2 Abs. 1 GG) des Hausrechtsinhabers in ihrem Gewicht zurück und stehen die Grundrechte des Betroffenen, namentlich dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und das Gebot der Gleichbehandlung (Art. 3 GG), bei der gebotenen Abwägung einem willkürlichen Ausschluss entgegen (vgl. Senat, Urteil vom 30. Oktober 2009 – V ZR 253/08, aaO; Urteil vom 9. März 2012 – V ZR 115/11, aaO Rn. 22). b) Diese Rechtsprechung bedarf im Hinblick auf die zwischenzeitlich ergangene Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur mittelbaren Drittwirkung von Art. 3 Abs. 1 GG im Verhältnis zwischen Privaten (BVerfGE 148, 267) der Modifizierung. aa) Danach folgt aus Art. 3 Abs. 1 GG kein objektives Verfassungsprinzip, wonach Rechtsbeziehungen zwischen Privaten von diesen prinzipiell gleichheitsgerecht zu gestalten wären. Dahingehende Anforderungen ergeben sich auch nicht aus den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung. Grundsätzlich gehört es zur Freiheit jeder Person, nach eigenen Präferenzen darüber zu bestimmen, mit wem sie unter welchen Bedingungen Verträge abschließen will (BVerfGE 148, 267 Leitsatz 1 und Rn. 40; vgl. auch BVerfG, NJW 2019, 3769 Rn. 6). Gleichheitsrechtliche Anforderungen für das Verhältnis zwischen Privaten können sich aus Art. 3 Abs. 1 GG jedoch für spezifische Konstellationen ergeben, etwa wenn der Ausschluss von Veranstaltungen, die aufgrund eigener Entscheidung der Veranstalter einem großen Publikum ohne Ansehen der Person geöffnet werden, für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet (vgl. BVerfGE 148, 267 Leitsatz 2 und Rn. 41). Indem ein Privater eine solche Veranstaltung ins Werk setzt, erwächst ihm von Verfassungs wegen auch eine besondere rechtliche Verantwortung. Er darf seine aus dem Hausrecht – so wie in anderen Fällen möglicherweise aus einem Monopol oder aus struktureller Überlegenheit – resultierende Entscheidungsmacht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis auszuschließen (vgl. BVerfGE 148, 267 Leitsatz 2 und Rn. 41; vgl. auch BVerfG, NJW 2019, 3769 Rn. 7). bb) Nach diesen Grundsätzen bedarf die Erteilung eines Hausverbots nicht schon dann eines sachlichen Grundes, wenn der Hausrechtsinhaber die Örtlichkeit für den allgemeinen Publikumsverkehr ohne Ansehen der Person öffnet, sondern nur unter der weiteren Voraussetzung, dass die Verweigerung des Zutritts für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheidet. In diesem Fall greift die Wirkung von Art. 3 Abs. 1 GG zwischen dem Betreiber einer solchen Einrichtung und deren (potentiellen) Besuchern, Gästen oder Kunden über die in Art. 3 Abs. 3 GG und in den §§ 19 ff. AGG besonders geregelten Diskriminierungsverbote hinaus und stellt die Ausübung des Hausrechts durch den Veranstalter bzw. Betreiber in einen Zusammenhang mit dem Recht des Einzelnen auf Teilhabe am kulturellen Leben (vgl. BVerfGE 148, 267 Rn. 42). Dem Betreiber einer Einrichtung, die erhebliche Bedeutung für das gesellschaftliche und kulturelle Leben hat, wird eine besondere rechtliche Verantwortung zugewiesen, die es ihm verbietet, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund auszuschließen. Welche Bedeutung der Zugang zu einer Einrichtung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat, ist daher nicht aus der Perspektive des einzelnen Besuchers zu beurteilen; vielmehr ist aus objektivierter Sicht desjenigen, der die Einrichtung dem allgemeinen Publikumsverkehr öffnet, zu fragen, welche Funktion die von ihm willentlich eröffnete und betriebene Einrichtung bei typisierender Betrachtung hat. Dies zeigt auch der von dem Bundesverfassungsgericht gezogene Vergleich zu anderen Fällen der mittelbaren Grundrechtswirkung, in denen insbesondere die Unausweichlichkeit von Situationen, das Ungleichgewicht zwischen sich gegenüberstehenden Parteien, die gesellschaftliche Bedeutung von bestimmten Leistungen oder die soziale Mächtigkeit einer Seite eine maßgebliche Rolle spielen (vgl. BVerfGE 148, 267 Rn. 33), wie etwa in den Fällen des Monopols oder der strukturellen Überlegenheit (vgl. BVerfGE 148, 267 Rn. 41)."
UPDATE: Zwischenzeitlich hat das LG Zwickau mit Beschluss vom 24.05.2022, Az. 6 S 141/21, das Urteil des AG Plauen vom 27.10.2021, Az. 7 C 736/20 bestätigt. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig.
hat das LG Zwickau, Mit Urteil vom 27.10.2021, Az. 7 C 736/20, hat das AG Plauen eine Klage gegen eine von uns vertretene Medienhändlerin auf Schadensersatz abgewiesen. Der Kläger hatte vor einigen Jahren bei unsere Mandantin eine "Alice Cooper"-CD erwerben und diese nun seinerseits (angeblich) privat auf eBay zum Verkauf angeboten. Wegen diese Angebots war er von der Hamburger Abmahnkanzlei Gutsch & Schlegel abgemahnt worden und, im einstweiligen Verfügungsverfahren, auf Unterlassen in Anspruch genommen worden, weil die Aufnahme angeblich ein Bootleg (eine nicht lizenzierte Aufnahme) gewesen sein soll. Die ihm dadurch entstandene Kosten verlangte er nun ersetzt. … mehr Das AG Plauen hat die Klage auf Kosten des Klägers als insgesamt unbegründet abgewiesen. Ein deliktischer Anspruch gegen die von uns vertretene Medienhändlerin bestehe nicht, weil diese nicht für das Angebot des Klägers auf eBay einzustehen habe: "Ein Anspruch aus Delikt gegen die Beklage besteht nicht. Selbst wenn die Beklagte den Tonträger … unter Verletzung von Urheberrechten Dritter an den Beklagten verkauft hätte, stünden diesem keine Schadenersatzansprüche zu. Denn einerseits dienen die urheberrechtlichen Vorschriften nicht dem Schutz des Käufers eines urheberrechtlich geschützten Gegenstands oder Rechts, sondern des Urhebers. Anderseits ist der vom Kläger geltend gemachten Schaden nicht dadurch entstanden, dass die Beklagte den Tonträger an ihn verkauft hat, sondern dadurch, dass der Kläger diesen in der weiteren Folge weiter veräußern wollte und ihn deshalb in Ebay feil bot." "Wenn der Tonträger, wie vom Kläger behauptet tatsächlich ein Bootleg gewesen sein sollte, hätte dem Tonträger ein Rechtsmangel angehaftet. … Diese Gewährleistungsansprüche bestehen jedoch lediglich dann, wenn der Rechtsmangel arglistig verschwiegen worden wäre (§ 438 Abs. 3 Satz 1 BGB). Andernfalls verjähren Gewährleistungsrechte gemäß § 438 Abs. 2 Nr. 3BGB)." "Ein Verschweigen des Mangels setzt voraus, dass der Mangel bekannt war. … Es wird auch nicht aus der Gesamtheit ersichtlich, dass die Beklagte erkannt hatte, dass es ich bei dem verkauften Tonträger um einen Bootleg handelte. Das wäre z.E. dann der Fall, wenn bereits die Inaugenscheinnahme dies nahe legt, etwa bei ersichtlichem selbst hergestellten Tonträgers wie eine selbst gebrannt CD oder DVD. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, besteht kein Anspruch, denn dann stünde die Frage im Raume, aus welchem Grunde der Kläger selbst vor dem An bieten des Tonträgers im Ebay, dies nicht erkannt. Schon gar nicht kann von Arglist au gegangen werden. Arglist bezeichnet eine absichtlich, bösartige Hinterlist, die unter Verstoß gegen Treu und Glauben zum Ausdruck kam. Dafür liegen keine Anhaltspunkte vor." Grundsätzlich müssen die (angeblichen) Rechteinhaber (bzw. deren Rechtsanwälte wie Gutsch & Schlegel) den behaupteten Rechtsverstoß (Bootlegs, Piracy, Grau-/ Parallelimport, etc.) nachweisen und dazu insb. ihre Rechteinhaberschaft und Anspruchsberechtigung lückenlos über die gesamte Rechtekette darlegen und beweisen. Hier konnten wir oft entschiedene Lücken in der sog. rechtekette aufzeigen und die von Gutsch & Schlegel und anderen Kanzleien gegen unseren Mandaten und Mandantinnen oft zu Fall bringen! Auch in Bezug auf die geltend gemachte Erstattung der Rechtsanwaltskosten lohnt ein genauer Blick. Insbesondere ist die außergerichtliche Inanspruchnahme mehrerer (angeblicher) Händler (auch verschiedene Handelsstufen!) nach neuester Rechtsprechung des Bundesgerichtshof u.U. gebührenrechtlich als eine Angelegenheit zu behandeln, wodurch nur ein Bruchteil der von Gutsch & Schlegl regelmäßig eingeforderten Gebühren erstattet werden müssen (BGH – Der Novembermann). Auch der geltend gemachte Schadensersatz, u.a die Kosten für die Ermittlung der angeblichen Rechtsverletzung durch die GUMPS GmbH (deren Gesellschafter und Geschäftsführer RAe Gutsch und Schlegel sind) wurde von den Gerichten bereits in mehreren Verfahren zurückgewiesen. gegen Medienhändler und private Anbieter (eBay-Verkäufe) vor. In den meisten Fällen konnten wir erreichen, dass gegen unsere Mandanten keine Klagen eingereicht wurden und konnten Klagen meist erfolgreich abwehren, u.a. Klagen betreffend die Musikgruppen/Musiker Iron Maiden, Genesis, Phil Collins. Klagen der Kanzlei Gutsch & Schlegel wurden hier abgewiesen (Amts- und Landgericht Hamburg).
Ebenfalls sei nicht feststellen, dass dieser (angebliche) Rechtsmangel von der Medienhändlerin arglistig verschweigen worden sei:
Zudem habe der Kläger dadurch, dass er sich nicht ausreichend gegen die Forderungen der Kanzlei Gutsch & Schlegel verteidigt habe, seiner Schadenminderungspflicht nicht genügt.
Auch dieser Fall zeigt, einmal mehr, dass Abmahnungen von Gutsch & Schlegel und anderen Abmahnkanzleien genau zu prüfen sind und vorschnelle Zugeständnisse unnötig teuer werden können!
Rechtsanwälte Gutsch & Schlegel gehen wegen angeblicher Bootleg-Aufnahmen, Parallelimporten etc. u.a. der Musiker/Musikgruppen
Mit Urteil vom 13.08.2020, Az. 29 U 1872/20, hat das OLG München entschieden, dass ein Kostenersatzanspruch für ein Abschlussschreiben (Aufforderung zur Abgabe einer Abschlusserklärung) nach Erlass einer einstweiligen Verfügung nur dann besteht, wenn dem Antragsgegner zuvor angemessene Zeit gewährt wurde, um die Abschlusserklärung unaufgefordert von sich aus abgeben zu können (sog. Wartefrist) und das Abschlussschreiben nicht zuvor "abbestellt" wurde. ... mehr Diese angemessene, eine Kostenersatzanspruch grundsätzlich auslösende Wartefrist für ein Abschlussschreiben beträgt in der Regel 2 bis 3 Wochen, je nachdem, ob es sich um eine Urteilsverfügung handelt oder um eine Verfügung, die im Beschlusswege erlassen wurde, vgl. BGH, Urteil vom 22.01.2015, Az. I ZR 59/14, Rz. 23 ff. – Kosten für Abschlussschreiben II: "bb) Wird eine einstweilige Verfügung durch Urteil erlassen oder nach Widerspruch bestätigt, so ist das kostenauslösende Abschlussschreiben nur erforderlich und entspricht nur dem mutmaßlichen Willen des Schuldners (§ 677 BGB), wenn der Gläubiger dem Schuldner zuvor angemessene Zeit gewährt hat, um die Abschlusserklärung unaufgefordert von sich aus abgeben zu können (KG, WRP 1978, 451; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 294; Teplitzky aaO Kap. 43 Rn. 31; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 12 Rn. 3.73). Außer dieser Wartefrist ist dem Schuldner eine Erklärungsfrist für die Prüfung zuzubilligen, ob er die Abschlusserklärung abgibt. Jedenfalls bei einer durch Urteil ergangenen oder nach Widerspruch bestätigten einstweiligen Verfügung ist es im Regelfall geboten und ausreichend, wenn der Gläubiger eine Wartefrist von zwei Wochen, gegebenenfalls unter Beachtung des § 193 BGB, einhält (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 294; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 12 Rn. 3.73; MünchKomm.UWG/Schlingloff, 2. Aufl., § 12 Rn. 557). Wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, wäre eine längere Wartefrist mit den berechtigten Interessen des Gläubigers nicht vereinbar. Der Gläubiger hat ein nachvollziehbares Interesse, alsbald Klarheit zu erlangen, ob er zur Durchsetzung seiner Ansprüche noch ein Hauptsacheverfahren einleiten muss. Dieses Interesse ergibt sich aufgrund des Schadensersatzrisikos aus § 945 ZPO und des Bedürfnisses, etwaige Folgeansprüche, deren Verjährung nicht durch das Verfügungsverfahren gehemmt ist, zusammen mit dem Unterlassungsanspruch geltend machen zu können. Keiner Entscheidung bedarf im Streitfall die Frage, ob die Kosten für ein Abschlussschreiben, das nach einer durch Beschluss erlassenen einstweiligen Verfügung abgesandt worden ist, grundsätzlich nur zu erstatten sind, wenn der Gläubiger eine längere Wartefrist als zwei Wochen eingehalten hat. Dafür könnte sprechen, dass dem Schuldner in diesem Fall regelmäßig keine begründete gerichtliche Entscheidung als Beurteilungsgrundlage zur Verfügung steht, und dass der Widerspruch nach §§ 935, 924 Abs. 1 ZPO unbefristet zulässig ist. Auch nach einer Beschlussverfügung wird die angemessene und erforderliche Wartefrist jedoch im Regelfall drei Wochen nicht überschreiten (vgl. BGH, Urteil vom 4. März 2008 – VI ZR 176/07, GRUR-RR 2008, 368 Rn. 12 = WRP 2008, 805)." "Rechtsfolge der zu kurz bemessenen Erklärungsfrist ist, dass die Klägerin, wenn sie die Hauptsacheklage vor Ablauf einer angemessenen Erklärungsfrist erhoben hätte, mit dem Kostennachteil aus § 93 ZPO hätte rechnen müssen. Enthält das Abschlussschreiben eine zu kurze Erklärungsfrist, so setzt es stattdessen eine angemessene Erklärungsfrist in Gang, während deren Lauf der Schuldner durch § 93 ZPO vor einer Kostenbelastung infolge der Erhebung der Hauptsacheklage geschützt ist (KG, WRP 1978, 451; OLG Zweibrücken, GRUR-RR 2002, 344; Ahrens/Ahrens aaO Kap. 48 Rn. 44; Fezer/Büscher aaO § 12 Rn. 179; Götting/Nordemann/Kaiser, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn. 321). Teilt der Antragsgegner dem Antragssteller jedoch vor Ablauf der angemessenen Wartefrist von 2 bzw. 3 Wochen nach Zustellung einer einstweiligen Verfügung mit, "dass es eines Abschlussschreibens nicht bedürfe", ohne sich mit dieser "Abbestellung" bereits verbindlich dazu zu äußern, ob er eine Abschlusserklärung abgegeben wird oder nicht, so hat der Antragssteller keinen Kostenersatzanspruch für ein (dennoch verschicktes) Abschlussschreiben, vgl. OLG München, Urt. v. 13.08.2020, Az. 29 U 1872/20, Rn. 26: "Die Funktion des Abschlussschreibens, der Aufforderung zur Abgabe einer Abschlusserklärung, liegt darin, dass der Gläubiger Klarheit gewinnt, ob er noch Hauptsacheklage erheben muss, und der Schuldner die Möglichkeit erhält, durch fristgerechte Abgabe der Abschlusserklärung den Rechtsstreit endgültig zu beenden (Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Aufl. § 12 Rn. 3.70). Beiden Funktionen konnte das Abschlussschreiben der Klägerin vom 02.07.2018 (Anlage K 8) aufgrund der vorausgehenden Schreiben der Beklagtenvertreter vom 26.06.2018 und 27.06.2018 nicht mehr gerecht werden. Wird eine einstweilige Verfügung erlassen, so ist das kostenauslösende Abschlussschreiben nur erforderlich und entspricht nur dem mutmaßlichen Willen des Schuldners (§§ 677 BGB), wenn der Gläubiger dem Schuldner zuvor angemessen Zeit gewährt hat, um die Abschlusserklärung unaufgefordert von sich aus abgeben zu können. Außer dieser Wartefrist ist dem Schuldner eine Erklärungsfrist für die Prüfung zuzubilligen, ob er die Abschlusserklärung abgibt (vgl. BGH GRUR 2015, 822 Rn. 17 – Kosten für Abschlussschreiben II; BGH GRUR 2017, 1160 Rn. 57 – Bretaris-Genuair). Danach muss dem Schuldner insgesamt ein der Berufungsfrist entsprechender Zeitraum zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, ob er den Unterlassungsanspruch endgültig anerkennen will (BGH GRUR 2015, 822 Rn. 18 – Kosten für Abschlussschreiben II). … Das Abschlussschreiben vom … konnte somit nicht mehr dazu dienen, der Beklagten die Möglichkeit, den Rechtsstreit durch Abgabe einer fristgerechten Abgabe einer Abschlusserklärung zu beenden, aufzuzeigen, denn dieser Möglichkeit war die Beklagte sich erkennbar bewusst. Das Abschlussschreiben konnte auch nicht dazu mehr dazu dienen, der Klägerin zeitnah Klarheit darüber zu verschaffen, ob sie zur Durchsetzung ihrer Ansprüche noch ein Hauptsacheverfahren einleiten muss. Denn die Monatsfrist entsprechend dem § 517 ZPO, innerhalb derer die Beklagte ohnehin schon zugesagt hatte, sich zur Anerkennung der einstweiligen Verfügung als endgültiger Regelung zu erklären, konnte die Klägerin durch das Abschlussschreiben nicht verkürzen.
Danach muss dem Schuldner insgesamt ein der Berufungsfrist entsprechender Zeitraum zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, ob er den Unterlassungsanspruch endgültig anerkennen will (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2005 – IX ZR 188/04, GRUR 2006, 349 Rn. 19 = WRP 2006, 352; KG, WRP 1978, 451; Fezer/Büscher aaO § 12 Rn. 182). Dem stehen keine überwiegenden Gläubigerinteressen entgegen. Der Unterlassungsanspruch des Gläubigers ist durch die einstweilige Verfügung vorläufig gesichert. Die Verjährungsfrist ist gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 9 BGB gehemmt. Es besteht daher keine besondere Eile, den Verbotsanspruch im Hauptsacheverfahren weiterzuverfolgen. Auf Seiten des Schuldners ist zu berücksichtigen, dass er sich durch Abgabe der Abschlusserklärung endgültig unterwerfen soll. Unter diesen Umständen ist es geboten, ihm nach Kenntnis der Begründung des die Verfügung bestätigenden Urteils ausreichend Zeit zur erneuten Prüfung des Sachverhalts und zur Einholung anwaltlichen Rats zu gewähren. Es ist daher im Regelfall sachgerecht, den Gläubiger mit der Kostenfolge aus § 93 ZPO zu belasten, wenn dem Schuldner für die Abgabe der Abschlusserklärung insgesamt nur eine kürzere Frist als die Berufungsfrist des § 517 ZPO zur Verfügung stand, der Gläubiger innerhalb dieser Frist Hauptsacheklage erhebt und der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt. …
Im Abschlussschreiben ist dem Antragsgegner sodann eine weitere, angemessene Prüf- und Erklärungsfrist von im Regelfall mindestens zwei Wochen für die Prüfung einzuräumen, ob er die Abschlusserklärung abgeben will (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 12 Rn. 3.71). Andernfalls hat der Anspruchssteller und Kläger bei einem sofortigen Anerkenntnis nach § 93 ZPO die Kosten des (voreilig) eingeleiteten Hauptsachverfahrens zu tragen, vgl. BGH, Urteil vom 22.01.2015, Az. I ZR 59/14, Rz. 23 ff. – Kosten für Abschlussschreiben II. Dies steht aber einem Anspruch auf Erstattung der Kosten des Abschlussschreibens nicht entgegen, vgl. BGH, Urteil vom 22.01.2015, Az. I ZR 59/14, Rz. 23 ff. – Kosten für Abschlussschreiben II:
Die Kosten für ein funktionsloses und damit überflüssiges Abschlussschreiben, das der Gläubiger dem Schuldner gegen dessen erklärten Willen aufdrängt, kann der Schuldner [richtig wohl: Gläubiger] nicht gemäß §§ 677, 683, 670 BGB ersetzt verlangen."
Der Bundesgerichtshof BGH hat heute in zwei Verfahren entschieden (Urteile vom 21. Januar 2021), dass das sog. Clickbaiting, das Ködern von Aufrufen einer Internetseite unter Nutzung von Bildern (Fotografien) Prominenter unzulässig sein kann und Schadensersatzansprüche (fiktive Lizenzgebühr) zumindest dann auslösen kann, wenn der Beitrag insg. "an der Grenze zu einer bewussten Falschmeldung und damit allenfalls am äußersten Rand des Schutzbereichs der Pressefreiheit" liegt (Verfahren zum Az. I ZR 1 0/19) bzw. bei einer "überwiegend kommerziellen Nutzung des Bildnisses" (Verfahren zum Az. I ZR 207/19). ... mehr Bei der nach 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG (Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte) notwendigen Abwägung der Interessen des Medienunternehmens (Presse-/Medienfreiheit; Informationsinteresse der Öffentlichkeit) und dem Interesse des Abgebildeten am Schutz seiner Persönlichkeit (Recht am eigenen Bild; Recht am eigenen Namen) überwiegen dann die Interessen des Abgebildeten. Mit den durch den Clickbait veranlassten Aufrufen würden zwar Werbeeinnahmen erzielt, die der Finanzierung der journalistischen Arbeit dienten. Dies rechtfertige es aber nicht, das Bildnis einer prominenten Person für eine Berichterstattung zu nutzen, die keinen inhaltlichen Bezug zu ihr aufweist bzw. die überwiegend kommerzielle Interessen verfolgt. "Bundesgerichtshof, Mitteilung der Pressestelle Nr. 014/2021 vom 21.01.2021 Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes für die Bebilderung eines "Urlaubslottos", Urteil vom 21. Januar 2021 – I ZR 207/19 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass die Nutzung des Bildnisses und des Namens eines prominenten Schauspielers zur Bebilderung des "Urlaubslottos" einer Sonntagszeitung einen rechtswidrigen Eingriff in den vermögensrechtlichen Bestandteil seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts dargestellt hat. Sachverhalt: Der Kläger ist Schauspieler und spielte im Zeitraum von 2014 bis 2019 in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" den Kapitän. Die Beklagte verlegt unter anderem eine Sonntagszeitung. Am 18. Februar 2018 erschien in der Sonntagszeitung unter der Überschrift "Gewinnen Sie Bares und eine Traumreise" ein Artikel zur Aktion "Urlaubslotto". Hierfür wurde bis auf die linke Spalte die gesamte Zeitungsseite genutzt. Unterhalb der Überschrift befand sich ein Foto, auf dem der Kläger als Kapitän mit zwei anderen Schauspielern der Serie in ihren jeweiligen Rollen abgebildet war. Das Foto nahm etwa ein Drittel des Artikels ein und wurde durch eine Bildunterschrift ergänzt, in der auch der bürgerliche Name des Klägers genannt war. Bisheriger Prozessverlauf: Das Landgericht hat der Klage auf der ersten Stufe durch Teilurteil stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Berufung hat das Berufungsgericht unter Neufassung des erstinstanzlichen Urteilstenors zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt hat, überwiegend zurückgewiesen und das Berufungsurteil damit bestätigt. Lediglich hinsichtlich des Auskunftsanspruchs hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch mit Recht zuerkannt. Die Beklagte hat in den vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt des Rechts am eigenen Bild des Klägers eingegriffen. Die Entscheidung, ob und in welcher Weise das eigene Bildnis für Werbezwecke zur Verfügung gestellt werden soll, ist wesentlicher – vermögensrechtlicher – Bestandteil des Persönlichkeitsrechts. Ein Eingriff in dieses Recht folgt im Streitfall bereits daraus, dass die Verwendung des Fotos – wie vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen – zu einem gewissen Imagetransfer vom Kläger in seiner beliebten Serienrolle auf den Hauptgewinn des Preisausschreibens der Beklagten geführt hat. Dieser Eingriff ist rechtswidrig. Eine Einwilligung des Klägers (§ 22 Satz 1 KUG) liegt nicht vor. Die Beurteilung, ob das Bildnis dem Bereich der Zeitgeschichte (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG) zuzuordnen ist und damit ohne Einwilligung des Abgebildeten genutzt werden darf, erfordert eine Abwägung zwischen dem Interesse des Klägers am Schutz seiner Persönlichkeit und dem von der Beklagten wahrgenommenen Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Mit Recht hat das Berufungsgericht die Interessen des Klägers höher gewichtet als die der Beklagten. Zu Gunsten der Beklagten ist zu berücksichtigen, dass sie ein Foto genutzt hat, das auch als Symbolbild für eine Kreuzfahrt im Sinne einer "Traumreise" steht und sich dadurch teilweise von der Person des Klägers gelöst hat. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Foto – selbst in einem redaktionellen Kontext – schrankenlos für die Bebilderung einer Kreuzfahrt genutzt werden darf. Der Symbolcharakter des Fotos ist vielmehr in die Interessenabwägung einzustellen. Diese fällt zu Gunsten des Klägers aus. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, die Veröffentlichung des Bildnisses sei nicht geeignet, einen nennenswerten Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Es hat der überwiegend kommerziellen Nutzung des Bildnisses des Klägers daher mit Recht entscheidende Bedeutung beigemessen. Die Informationen, die der Beitrag mit Blick auf die Person des Klägers und seine Rolle als Kapitän in der Fernsehserie "Das Traumschiff" enthält, sind der Bewerbung des "Urlaubslottos" der Beklagten funktional untergeordnet. Die Beklagte hat ihr Gewinnspiel dadurch aufgewertet, dass sie eine gedankliche Verbindung zwischen dem ausgelobten Hauptpreis einer Kreuzfahrt und der Fernsehserie "Das Traumschiff" hergestellt hat. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht zudem einen Unterlassungsanspruch wegen einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Ausprägung des Rechts am eigenen Namen des Klägers bejaht. Vorinstanzen: Die maßgeblichen Vorschriften lauten: § 22 Satz 1 KUG § 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 KUG
Unterhalb des Fotos wurde das "Urlaubslotto" erläutert. Zudem waren dort vier stilisierte Reisekoffer abgebildet. Jeder Koffer war mit einem aufgedruckten individuellen Zahlencode versehen. Die Leser konnten bis zum 24. Februar 2018 um 24 Uhr per Anruf oder SMS an eine Mehrwertdienstenummer zu regulären Kosten von jeweils 50 Cent überprüfen, ob auf diese Zahlencodes ein Bargeldgewinn von 100 €, 1.000 € oder 5.000 € entfiel. Unter allen Teilnehmern wurde außerdem als Hauptgewinn eine 13-tägige Kreuzfahrt verlost. Dies wurde im unteren Teil des Artikels unter der Überschrift "So können Sie auf dem Luxusschiff in See stechen" näher ausgeführt.
Im Wege der Stufenklage hat der Kläger die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Erstattung von Abmahnkosten (erste Stufe) und Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr (zweite Stufe) in Anspruch genommen.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Ein Anspruch auf Auskunft über die Druckauflage der Sonntagszeitung der Beklagten vom 18. Februar 2018 steht dem Kläger jedoch nicht zu. Zur Bezifferung seines Anspruchs kann er sich auf die im Internetauftritt der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) verfügbare Durchschnittsauflage im I. Quartal 2018 stützen.
LG Köln – Urteil vom 30. Januar 2019 – 28 O 216/18
OLG Köln – Urteil vom 10. Oktober 2019 – 15 U 39/19
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
(…)
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird."
Das Kammergericht Berlin hat mit Urteil v. 16. Januar 2020 (Az. 2 U 12/16 Kart) entschieden, dass "eine am Computer mittels elektronischer Befehle erstellte Abbildung eines virtuellen Gegenstandes" kein wie ein Lichtbild im Sinne des § 72 UrhG hergestelltes Bild darstellt und daher keinen Schutz nach § 72 ff. UrhG genießt. Eine derart erstellte Grafik genießt Schutz nach dem Urhebergesetz daher nur dann, wenn sie ausreichende Schöpfungshöhe i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG hat, und damit als 'Werk' zu qualifizieren ist. ... mehr Vorliegend kam das Kammergericht (anders noch als die Vorinstanz) zu dem Ergebnis, dass es sich mit den streitgegenständlichen Bildern weder um geschützte Werke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG (Werke der bildenden Kunst) noch § 2 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 UrhG (Wissenschaftliche oder technische Darstellungen) handelt: "Unter den Begriff der bildenden Kunst fallen alle eigenpersönlichen Schöpfungen, die mit den Darstellungsmitteln der Kunst durch formgebende Tätigkeit hervorgebracht werden. Diesen Schutz können grundsätzlich auch Computeranimationen oder -grafiken genießen (OLG Hamm, Urteil vom 24. August 2004 – 4 U 51/04), wenn sie nicht lediglich auf der Tätigkeit des Computers beruhen (Schricker/Loewenheim, § 2 UrhG Rn. 135). Dabei ist für ein Werk der bildenden Kunst einschließlich der angewandten Künste eine persönliche geistige Schöpfung nach § 2 Abs. 2 UrhG erforderlich. Eine persönliche geistige Schöpfung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Schöpfung individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauung einigermaßen vertrauten Kreise von einer „künstlerischen" Leistung gesprochen werden kann (BGH, Urteile vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 Rn. 15, Geburtstagszug, vom 1. Juni 2011 – I ZR 140/09, Lernspiele, vom 12. Mai 2011 – I ZR 53/10, Seilzirkus, vom 10. Dezember 19786 – I ZR 15/85, Le-Corbusier-Möbel, alle zitiert nach juris). Es ergibt sich insoweit auch aus der Cofemel-Entscheidung des EuGH (Entscheidung vom 12. September 2019 – C-683/17, zitiert nach juris), in welcher dieser an seine ständige Rechtsprechung anknüpft, kein anderer Prüfungsmaßstab. … Nach Einschätzung des Senats, der aus eigener Anschauung die Werkqualität der streitgegenständlichen Abbildung zu beurteilen vermag, fallen die Grafiken des Zeugen F… nicht in den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG, da diese eine eigene geistige Schöpfung nicht erkennen lassen. … "Für Erzeugnisse der angewandten Kunst gelten in Abkehr von der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keine erhöhten Anforderungen mehr als bei Werken der zweckfreien Kunst. Gleichwohl ist bei der Beurteilung, ob die weiterhin erforderliche Gestaltungshöhe erreicht ist, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz jedenfalls nur dann begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht (BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 – I ZR 53/10, Seilzirkus, zitiert mach juris). Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt voraus, dass ein Gestaltungsspielraum besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise zum Ausdruck zu bringen. Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig eingeschränkt (BGH, Urteile vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 Rn. 15, Geburtstagszug, zitiert mach juris). Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maße die Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die einen Urheberrechtsschutz rechtfertigt (BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 – I ZR 53/10, Seilzirkus, m. w. N., zitiert mach juris). Auch diesen abgesenkten Schutzanforderungen genügen die im Antrag der Klägerinnen auf den dortigen Seiten 2 und 3 abgedruckten Abbildungen nicht. … Aber selbst wenn der Vortrag der Klägerinnen unterstellt wird, wonach der Zeuge F… bei der Gestaltung der Farben, der Kontraste und der Lichtreflexe einen Gestaltungsspielraum besessen hat, kann dies für die Annahme eines Urheberrechtsschutzes nicht genügen. … Schließlich wird das Fehlen der Schutzfähigkeit der Abbildungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG auch durch die Aussage des Zeugen F… in seiner Vernehmung vom 17. November 2015 gestützt. So hielt dieser es für möglich, dass er die Bilder, die ihm vorgelegt worden waren, gefertigt habe, wobei er sich zu 90 % sicher war. Zu 100 % war er sich hingegen über seine Urheberschaft nur bei solchen Bildern sicher, die er selbst unterschrieben hatte. Wenn sich jedoch schon der vermeintliche Urheber eines Werkes selbst mangels bestimmter eigenschöpferischer Züge erst durch Hinzuziehung weiterer Kriterien, wie seiner Unterschrift, nicht ohne letzten Zweifel sicher ist, dass die Bilder seiner Urheberhaft entstammen – bildlich gesprochen: seine „künstlerische Handschrift" tragen –, indiziert dies gerade nicht eine besondere Originalität des Werkes, anhand derer jedenfalls der Urheber sein eigenes Werk eindeutig wiedererkennen sollte. … Die Werke nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG lassen sich von Werken der bildenden Kunst durch ihren Zweck abgrenzen. Anders als die Werke der bildenden Kunst, die in erster Linie der reinen Anschauung dienen, also ihren Zweck in sich selbst tragen, dienen die wissenschaftlichen oder technischen Werke der Informationsvermittlung im Sinne einer Belehrung oder Unterrichtung (OLG München, Urteil vom 19. September 1991 – 6 U 2093/88; KG, Urteil vom 11. Juli 2000 – 5 U 3777/09, Memo-Kartei; Nordemann, in: Fromm/Nordemann, 12. Auflage 2018, § 2 UrhG Rn. 210 f.; Schulze, in: Dreier/Schulze/Specht, 6. Auflage 2018, § 2 UrhG Rn. 222). Vorliegend ergibt sich schon aus dem Sachkontext, in dem die streitgegenständlichen Abbildungen als Produktwerbung beauftragt wurden, dass weder die wissenschaftliche noch die technische Informationsvermittlung, sondern einzig die Produktwerbung als Kaufanreiz im Vordergrund der Abbildungen stehen sollte." Zum Schutz als (einfache) Lichtbilder führt das Kammergericht aus: "Lichtbilder und ähnlich hergestellte Erzeugnisse, die die Schöpfungshöhe des § 2 UrhG nicht erreichen, können unter den Voraussetzungen des § 72 UrhG ebenfalls geschützt sein, wobei ein Minimum eigener Leistung jedoch auch hierfür gegeben sein muss (Meckel in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 4. Aufl. 2018, § 72 UrhG Rn. 1). Vorliegend handelt es sich bei den Grafiken des Zeugen F… aber weder um Lichtbilder noch um diesen gleichgestellte Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden. a) Lichtbilder Bei den streitgegenständlichen Bildern handelt es sich nicht um Lichtbilder. Hierunter werden zunächst alle Abbildungen gezählt, die dadurch entstehen, dass strahlungsempfindliche Schichten chemisch oder physikalisch durch Strahlung eine Veränderung erfahren (BGH, Beschluss vom 27. Februar 1962 – I ZR 118/60, AKI, GRUR 1962, 470 472; Vogel in: Schricker/Loewenheim, 4. Aufl., § 72 UrhG Rn. 18). Dies ist bei am Computer erstellten Grafiken jedenfalls schon nicht der Fall. b) Erzeugnisse, die ähnlich wie ein Lichtbild hergestellt werden Bei den von dem Zeugen F… erstellten Grafiken handelt es sich aber auch nicht um Erzeugnisse, die ähnlich wie ein Lichtbild hergestellt werden. Ausgangspunkt der vorzunehmenden Auslegung des § 72 UrhG ist der Wortlaut der Norm, wonach maßgeblich auf den Schaffensvorgang und nicht auf das Ergebnis des Schaffensprozesses abgestellt wird. Dementsprechend kann für die Beantwortung der Frage, was unter „Erzeugnissen, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden" zu verstehen ist, allein das Ergebnis des Herstellungsverfahrens letztlich nicht maßgeblich sein. Andernfalls wäre bereits jedes Bild, das optisch wie eine Fotografie wirkt, etwa fotorealistische Werke, als lichtbildähnliches Erzeugnis einzuordnen (vgl. Nordemann in: Fromm/Nordemann, 12. Aufl. 2018, § 2 UrhG Rn. 193). Durch eine solche Auslegung würden jedoch die Grenzen zu den Schöpfungen, die von ihrer Entstehungsweise her eher Zeichnungen ähneln und die damit dem Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 7 UrhG zuzuordnen sind, verschwimmen. Erforderlich ist nach dem Wortlaut der Norm vielmehr, dass ein ähnliches Herstellungsverfahren wie bei der Erstellung von Lichtbildern angewandt wird. Insoweit kommt es jedoch nicht entscheidend auf den Schaffensvorgang aus Sicht des Anwenders der Technik, sondern auf die Vergleichbarkeit der technischen Prozesse an. Aus der Perspektive des Anwenders könnte eine Ähnlichkeit der Herstellung durchaus angenommen werden, da ausgehend von dem Vortrag der Klägerinnen der Schaffensprozess bei der Erstellung der Computergrafiken dem des Fotografierens stark ähnelt. Dem Vortrag der Klägerinnen folgend hat der Zeuge F… die digital nachgebauten Gegenstände zunächst räumlich in ganz bestimmter Weise zueinander angeordnet, eine bestimmte Farbwahl getroffen und sodann über Art, Anzahl und Position der Lichtquellen entschieden, um die Produkte individuell auszuleuchten und entsprechende Schattenwürfe zu erzeugen. Anders als in anderen Fallkonstellationen hat also das Computerprogramm die Grafik nicht quasi „selbständig hervorgebracht" (vgl. hierzu OLG Hamm, Urteil vom 24. August 2004 – 4 U 51/04, zitiert nach juris), sondern den Grafiken liegt eine persönliche Leistung bezüglich der Anordnung der Objekte, der Bildgestaltung durch Bildausschnitt sowie der Licht- und Schattenverteilung zugrunde, die der Tätigkeit eines Fotografen im Wesentlichen entspricht. Der Umstand, dass im Rahmen der Reformierung des Urheberrechts im Jahre 1962 bereits das Bewusstsein vorhanden war, dass das Urheberrecht durch technische Entwicklungen stark beeinflusst wird, es stets zu neuen Fragen der Anwendbarkeit kommt und es daher den technischen Möglichkeiten hinterherhinkt (vgl. BT-Drs. IV/220, S. 27), kann vorliegend nicht zu einer anderen Bewertung führen. … Die Forderung nach der Einbeziehung derartiger Grafiken in den Schutzbereich des § 72 UrhG mit Blick auf die Entwicklung der Computertechnologie, die zu völlig neuen Gestaltungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten geführt hat, ist zwar nachvollziehbar. Dabei verkennt der Senat auch nicht, dass sich bereits heute deutliche Wertungswidersprüche ergeben. So werden etwa Digitalfotos als Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, angesehen (vgl. hierzu etwa LG Hamburg, Urteil vom 4. April 2003 – 308 O 515/02, ZUM 2004, 675, 677; LG Kiel, Urteil vom 2. November 2004 – 16 O 112/03, zitiert nach juris), obwohl diese in technischer Hinsicht der Herstellung von Computergrafiken näher kommen dürften als der analogen Fotografie. Auch bezüglich der mittels Computer geschaffenen Video- und Computerspiele, die urheberrechtlichen Schutz genießen (BGH, Urteil vom 26. Juli 2018 – I ZR 64/17, zitiert nach juris), ergibt sich ein Bruch, wenn das, was für die gesamte Bildabfolge gilt, nicht auch für einzelne Teile hiervon Geltung hat (so etwa Schulze in: Dreier/Schulze/Sprecht, 6. Auflage 2018, § 2 UrhG Rn. 200). Ebenso wenig stimmig ist es, wenn ein praktisch von jedermann herzustellendes einfaches Lichtbild eines Parfumflakons bereits (leistungs)schutzfähig sein soll, während eine aufwändig hergestellte und bearbeitete Visualisierung allenfalls Schutz als Werk der angewandten Kunst in Anspruch nehmen kann, obwohl beide Abbildungen dem Betrachter in ihren Grundzügen denselben optischen Eindruck vermitteln (zu diesem Wertungswiderspruch ebenfalls bereits LG Berlin, Urteil vom 20. Juni 2017 – 16 O 59/16, zitiert nach juris). Dieser Bruch ist jedoch bereits im Gesetz angelegt, so dass es auch Aufgabe des Gesetzgebers ist, die bestehenden Regelungen unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung sinnvoll anzupassen."
Dies genügt jedoch nicht, um von einem lichtbildähnlichen Erzeugnis auszugehen. Zentrales Argument für die Privilegierung der Lichtbilder war der Einsatz der Technik der Fotografie. Im Rahmen der Begründung des Entwurfs eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte wurde ausdrücklich herausgestellt, dass es bei dem Schutz der Lichtbilder nicht um den Schutz einer schöpferischen Leistung, sondern um den einer rein technischen Leistung gehe, die nicht einmal besondere Fähigkeiten voraussetze (vgl. BT-Drs. IV/220, S. 37, 88). Charakteristische Merkmale der Fotografie sind aber zum einen der Einsatz von strahlender Energie und zum anderen die Abbildung eines im Moment der Bilderschaffung vorhandenen, körperlichen Gegenstandes (so auch in einer nach dem hier angefochtenen Entscheidung LG Berlin, Urteil vom 20. Juni 2017 – 16 O 59/16, zitiert nach juris; anders aber Schulze in: Dreier/Schulze/Sprecht, 6. Auflage 2018, § 2 UrhG Rn. 200; vgl. auch Büchner, ZUM 2011, 549, 551). Eben jene Merkmale erfüllen die von dem Zeugen F… erstellten Grafiken indes nicht. Es handelt sich hierbei gerade nicht um unter Einsatz strahlender Energie erzeugte selbstständige Abbildungen der Wirklichkeit, sondern vielmehr um mittels elektronischer Befehle erzeugte Abbildungen von virtuellen Gegenständen (vgl. hierzu OLG Köln, Urteil vom 20. März 2009 – 6 U 183/08, 3D-Messestände,; OLG Hamm, Urteil vom 24. August 2004 – 4 U 51/04, beide zitiert nach juris; Dreyer in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, 4. Aufl. 2018, § 2 UrhG Rn. 265; Gercke, ZUM 2004, 929, 930; Lauber-Rönsberg in: Möhring/Nicolini, 4. Aufl. 2018, § 72 UrhG Rn. 11; Nordemann in: Fromm/Nordemann, 12. Aufl. 2018, § 2 UrhG Rn. 193; Thum in: Wandtke/Bullinger, 5. Aufl. 2019, § 72 UrhG Rn. 60; für eine weite Auslegung Härting in: Härting, Internetrecht, 6. Aufl. 2017, Urheberrecht, Rn.1401; Schulze in: Dreier/Schulze/Specht, 6. Aufl. 2018, § 2 UrhG Rn. 200 m. w. N.; offen gelassen von LG Köln, Urteil vom 21. April 2009 – 28 O 124/08, zitiert nach juris).
Wie schon hinsichtlich die sog. Verlegerbeteiligung hat das Landgericht München I mit Urteil vom 04.10.2021 (Az. 42 O 13841/19) festgestellt, dass die Beteiligung von Herausgebern und die Zahlungen an den Förderungsfonds Wissenschaft durch die VG Wort rechtswidrig war und ist. ... mehr Im Hinblick auf die Ausschüttungen an Herausgeber stellte das Gericht fest, dass die Wahrnehmung von Rechten von Herausgebern schon nicht vom bis ins Jahr 2018 geltenden satzungsgemäßen Aufgabenumfang der Beklagten umfasst war. Selbst wenn man die Satzung weiter auslegen wollte, wären die Ausschüttungen dennoch zu Unrecht erfolgt, da die Regelungen des Verteilungsplans der Beklagten, die die Ausschüttungen im Einzelnen zuweisen, nicht an eine tatsächliche Berechtigung anknüpfen und daher willkürlich und unwirksam sind. In Bezug auf die Ausschüttungen nach der Satzungsänderung, gemäß der nunmehr die Beklagte die Rechte von Urhebern und Nutzungsrechtsinhabern an Sammelwerken wahrnimmt,stellte das Gericht fest, dass die Satzungsänderung mangels wirksamer schriftlicher Mitteilung gegenüber den Inhabern von Altverträgen schon nicht wirksam geworden war, und zudem der Verteilungsplan der Beklagten und ihre Verwaltungspraxis nicht sicherstellen, dass tatsächlich nur Ausschüttungen an Berechtigte, nämlich an Urheber oderI nhaber von Nutzungsrechten an Sammelwerken vorgenommen werden. Daher waren auch die Ausschüttungen an Herausgeber nach der erfolgten Satzungsänderung unwirksam. Die Ausschüttungen an den Förderungsfonds Wissenschaft der VG Wort waren ebenfalls unwirksam. Nach höchstrichterlicher und europarechtlicher Rechtsprechung müssen die Einnahmen aus den gesetzlichen Vergütungsansprüchen nach §§ 27, 54 ff UrhG unbedingt unmittelbar und originär berechtigten Urhebern zu Gute kommen (BGH, GRUR 2016, 596 – Verlegeranteil; EuGH, GRUR 2013, 1025 – Amazon/AustroMechana). Die von der VG Wort vorgenommenen Zuschüsse an den Förderungsfonds Wissenschaft GmbH erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Die vollständige Pressemitteilung 26/21 des LG München I finden sie hier: PM 26-2021
Mit Urteil vom 27. Mai 2021, Az. I ZR 119/20 – Lautsprecherfoto, hat der BGH eine Entscheidung des LG und des OLG Frankfurt bestätigt, wonach keine öffentliche Wiedergabe und keine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wenn zur Aufrufung des Fotos eine URL eingegeben werden muss, die 70 Zeichen umfasst; entsprechend war im konkreten Fall auch keine Vertragsstrafe geschuldet, a.a.O, Leitsatz: ... mehr "Das für die Prüfung der öffentlichen Zugänglichmachung relevante Kriterium "recht viele Personen" ist nicht erfüllt, wenn ein Produktfoto, dass zunächst von einem Verkäufer urheberrechtsverletzend auf einer Internethandelsplattform im Rahmen seiner Verkaufsanzeige öffentlich zugänglich gemacht worden war, nach Abgabe einer Unterlassungserklärung des Verkäufers nur noch durch die Eingabe einer rund 70 Zeichen umfassenden URL-Adresse im Internet zugänglich war und nach der Lebenserfahrung davon auszugehen ist, dass die URL-Adresse nur von Personen eingegeben wird, die diese Adresse zuvor – als das Foto vor Abgabe der Unterlassungserklärung noch im Rahmen der Anzeige des Verkäufers frei zugänglich gewesen war – abgespeichert oder sie sonst in irgendeiner Weise kopiert oder notiert haben, oder denen die Adresse von solchen Personen mitgeteilt worden war." Sowie a.a.O., Rz. 14 ff.: "3. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass nach den Umständen des Streitfalls jedenfalls das Merkmal der Öffentlichkeit im Sinne der vorstehend wie- dergegebenen Grundsätze nicht erfüllt ist. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. a) Bei der Prüfung, ob die mit dem Kriterium "recht viele Personen" umschriebene Mindestschwelle überschritten ist, mit der eine allzu kleine oder gar unbedeutende Mehrzahl betroffener Personen aus dem unionsrechtlich determinierten Begriff der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden soll, handelt es sich um eine den nationalen Gerichten überantwortete Tatsachenbeurteilung (vgl. EuGH GRUR 2012, 593 Rn. 93 – SCF; GRUR 2012, 597 Rn. 39 – Phonographic Performance (Ireland)). Die vorzunehmende tatgerichtliche Würdigung ist nach den allgemeinen Grundsätzen vom Revisionsgericht überprüfbar. Danach ist maßgeblich, ob das Tatgericht einen zutreffenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder die Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2020 – I ZR 137/19, GRUR 2021, 473 Rn. 21 = WRP 2021, 196 – Papierspender, mwN). b) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Wiedergabe gegenüber "recht vielen Personen" liege auf der Grundlage der vom Kläger vorgetragenen Umstände nicht vor. Das streitgegenständliche Foto sei nur durch die Eingabe der rund 70 Zeichen umfassenden URL-Adresse im Internet zugänglich gewesen. Damit beschränke sich der relevante Personenkreis faktisch auf diejenigen Personen, die diese Adresse zuvor – als das Foto vor Abgabe der Unterlassungserklärung noch im Rahmen der eBay-Anzeige des Beklagten frei zugänglich gewesen sei – abgespeichert oder sie sonst in irgendeiner Weise kopiert oder notiert hätten, oder denen die Adresse von solchen Personen mitgeteilt worden sei. Es widerspreche jeder Lebenserfahrung, dass außer dem Kläger noch "recht viele" andere Personen die URL-Adresse gekannt und Zugang zu dem Foto gehabt haben könnten. Diese tatgerichtliche Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand."
Mit Urteil vom 09.05.2019, Az. 310 O 146/18, hat das Landgericht Hamburg erneut bestätigt, dass bei dem Angebot und Vertrieb von "illegalen" Musikaufnahmen (Bootlegs, Parallelimporten, etc.) durch Distributoren oder Einzelhändler als Schadensersatz, wenn überhaupt, nur eine geringe Stücklizenz von wenigen (2-4 USD/GBP/EUR) geschuldet ist: … mehr "Die Höhe der Zahlungsansprüche der Klägerin bemisst sich danach, was vernünftige Vertragsparteien als angemessene Lizenz vereinbart hätten. Das Gericht geht im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO davon aus, dass vernünftige Vertragsparteien eine Stücklizenz von EUR 4,00 je CD vereinbart hätten: Es ist zunächst festzustellen, dass für die Lizenzierung von Parallelimporten keine Lizenzpraxis vorgetragen wurde. Die Klägerin trägt vielmehr selbst vor, solche "Nutzungen" "naturgemäß" nicht zu lizenzieren … Soweit die Klägerin geltend macht, vernünftige Verhandlungsparteien hätten nicht nur eine Stücklizenz vereinbart, sondern (nicht mit späteren Stücklizenzen zu verrechnende) Vorauszahlungen, überzeugt dies nicht. Der von der Klägerin insoweit bemühte Vergleich zur eigenen Praxis (wenn die Klägerin selbst Lizenzen erwirbt) passt nicht: Der Kammer erscheint eine Stücklizenz von EUR 4,00 angemessen (§ 287 ZPO). Der Betrag liegt innerhalb des von der Klägerin vorgetragenen, für die Kammer auch unter Berücksichtigung des Bestreitens der Beklagten überzeugenden Rahmens … und passt zu dem von Klägerseite behaupteten Händlerabgabepreis … je CD. Der behauptete Händlerabgabepreis wiederum passt zu den. der Kammer bekannten üblichen Einzelhändler-Verkaufspreisen …" Im konkreten Fall ging es dabei um aktuelle Aufnahmen (CDs ) der Musiker Sting, Lorde und Kate Perry. Bei älteren Aufnahmen (back catalog) und Aufnahmen weniger bekannter Künstler ist die Lizenzspanne entsprechend geringer. Die von den einschlägigen Abmahnkanzleien regelmäßig geforderten Pauschalbeträge i.H.v. teilweise mehreren Tausend Euro erweisen sich damit als rechtswidrig überhöht, was auch ein Indiz für die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Abmahnung ist, vgl. BGH, Urteil vom 28. Mai 2020, Az. I ZR 129/19 und § 8c Abs. 2 UWG n.F. Ebenfalls hat das LG Hamburg wiederholt entschieden, dass auch sog. "Ermittlungsgebühren" (bspw. der GUMPS GmbH), die von Abmahnkanzleien ebenfalls regelmäßig eingefordert werden, von Abgemahnten nicht erstattet werden müssen.
Mit Urteil v. 28.09.2021, VI ZR 1228/20 (https://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20210163) hat der BGH entschieden, dass der Betroffene einen Anspruch auf Löschung einer selbst erwirkten Gegendarstellung aus dem Online-Archiv eines Presseorgans (hier des Online-Portals www.bild.de) hat, wenn die unzulässige Erstmitteilung dort nicht mehr zum Abruf vorgehalten wird: … mehr "1. Der Gegendarstellungsanspruch dient seiner Natur nach vorrangig dem Schutz des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen (vgl. Senatsurteil vom 6. April 1976 – VI ZR 246/74, BGHZ 66, 182, 195, juris Rn. 122). Demjenigen, dessen Angelegenheiten in den Medien öffentlich erörtert werden, wird ein Anspruch darauf eingeräumt, an gleicher Stelle, mit derselben Publizität und vor demselben Forum mit einer eigenen Darstellung zu Wort zu kommen; er kann sich alsbald und damit besonders wirksam verteidigen, während etwaige daneben bestehende zivil- und strafrechtliche Mittel des Persönlichkeitsschutzes bei Durchführung des Hauptsacheverfahrens regelmäßig erst in einem Zeitpunkt zum Erfolg führen, in dem der zugrundeliegende Vorgang in der Öffentlichkeit bereits wieder vergessen ist (BVerfGE 63, 131, 142, juris Rn. 29 f.). Die Gegendarstellung bleibt dabei stets an eine Erstmitteilung in der Presse gebunden. Nur wer zunächst von ihr zum Gegenstand öffentlicher Erörterung gemacht worden ist, kann die Wiedergabe seiner Darstellung verlangen. Schließlich ist der Anspruch auch nach Gegenstand und Umfang durch die Erstmitteilung begrenzt. Der Betroffene kann nur den in der Erstmitteilung enthaltenen Tatsachen widersprechen und muss dabei einen angemessenen Rahmen wahren, der regelmäßig durch den Umfang des beanstandeten Textes bestimmt wird (vgl. BVerfGE 97, 125, 147, juris Rn. 117). Die Gegendarstellung ist damit von der Erstmitteilung abhängig (vgl. BVerfG, NJW 2018, 1596 Rn. 18). 2. Vor diesem Hintergrund kann der Kläger nach den Umständen des Falles von der Beklagten die Entfernung seiner Gegendarstellung vom 24. Januar 2016 aus deren Online-Archiv verlangen, § 1004 Abs. 1 Satz 2 analog, § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG. a) Mit dem fortdauernden Vorhalten der Gegendarstellung zum Abruf in ihrem Online-Archiv greift die Beklagte in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers in seiner Ausprägung als Recht der persönlichen Ehre und des guten Rufes ein. Durch die Bezugnahme auf die Erstmitteilung werden die dort enthaltenen – unwahren – Vorwürfe in der Gegendarstellung gespiegelt und damit – wenn auch in verneinter und damit für sich genommen zutreffender Form – in Erinnerung gerufen. Auch wenn die hier maßgeblichen Behauptungen der Erstmitteilung in der Gegendarstellung in Abrede sowie in der redaktionellen Anmerkung der Beklagten richtig gestellt werden, machen sie diese doch gleichsam im Reflex weiterhin zugänglich, geben Anlass und eröffnen Raum für Spekulation und beeinträchtigen damit das Ansehen des Klägers – semper aliquid haeret. Dem steht nicht entgegen, dass der Kläger die Gegendarstellung selbst formuliert und die Beklagte sie ursprünglich auf Verlangen des Klägers auf ihrer Webseite eingestellt hat. Denn der Kläger war gegendarstellungsrechtlich gehalten, bei Formulierung seiner Gegendarstellung an die Erstmitteilung anzuknüpfen, die Erstmitteilung folglich konkret zu bezeichnen und diejenigen Tatsachenbehauptungen, gegen die er sich wenden wollte, konkret und zutreffend wiederzugeben (vgl. Soehring/Hoene, Presserecht, 6. Aufl., Rn. 29.28; Burkhardt in Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 6. Aufl., Kap. 11 Rn. 78 ff., Seitz, Gegendarstellungsanspruch, 5. Aufl., S. 84 ff.; Schulenberg in Schwartmann, Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht, 4. Aufl., Kap. 9 Rn. 232; jeweils mwN). Der Kläger hat damit nicht etwa freiwillig selbst die nun beanstandeten Informationen offenbart, sondern war hierzu durch die – unwahre Tatsachenbehauptungen enthaltende – Erstmitteilung der Beklagten gezwungen, wenn er von seinem Recht auf Gegendarstellung Gebrauch machen wollte. Diese Rechtsausübung kann jedenfalls im Verhältnis zum Erstschädiger nicht gegen ihn gewendet werden. Andernfalls führte die verfahrensrechtliche Ausgestaltung des Gegendarstellungsrechts, die sich ebenfalls an dem in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleisteten Persönlichkeitsrecht messen lassen muss (vgl. BVerfGE 63, 131, 143, juris Rn. 31), im Ergebnis zu einer Entwertung der materiellen Grundrechtsposition des Klägers. b) Die Beeinträchtigung ist auch rechtswidrig. aa) Wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als Rahmenrecht liegt seine Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch eine Abwägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange bestimmt werden, bei der die besonderen Umstände des Einzelfalls sowie die betroffenen Grundrechte und Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention interpretationsleitend zu berücksichtigen sind. Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betroffenen die schutzwürdigen Belange der anderen Seite überwiegt (st. Rspr., vgl. zuletzt nur Senatsurteil vom 29. Juni 2021 – VI ZR 52/18, AfP 2021, 322 Rn. 24 mwN). Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt ist dabei der Zeitpunkt des Löschungsverlangens. Im Streitfall ist das durch Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete Interesse des Klägers am Schutz seines Persönlichkeitsrechts mit dem in Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK verankerten Recht der Beklagten auf Presse- und Meinungsfreiheit abzuwägen. bb) Diese Abwägung fällt hier zugunsten des Klägers aus.Abs. 32 (1) Maßgeblicher Gegenstand der Abwägung ist allein der Inhalt der Gegendarstellung einschließlich der redaktionellen Anmerkung der Beklagten betreffend die beiden unwahren Tatsachenbehauptungen der Beklagten, gegen den Kläger werde wegen des Verdachts der Zuhälterei ermittelt und er habe den Großteil der Taten gestanden. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Abwägung nicht um den übrigen – zudem nicht mehr abrufbaren – Inhalt der Erstmitteilung vom 15. Januar 2016 zu erweitern. Zwar mag der Kläger mit der von ihm verübten Straftat insgesamt den Anlass zur Erstmitteilung vom 15. Januar 2016 gegeben haben. Doch handelt es sich, anders als die Revision meint, nicht etwa um die unnatürliche Aufspaltung eines einheitlichen Lebenssachverhalts (§ 286 ZPO), wenn der Frage der Rechtmäßigkeit der Erstmitteilung im Übrigen (vgl. hierzu aber Senatsurteil vom 17. Dezember 2019 – VI ZR 249/18, AfP 2020, 143) im Streitfall kein entscheidendes Gewicht zukommt. Eine unzulässige Äußerung wird nicht dadurch zulässig, dass eine (darin in Bezug genommene) Mitteilung im Übrigen zulässige Äußerungen enthält. (2) Auch wenn die Gegendarstellung für sich genommen lediglich wahre Tatsachenbehauptungen enthält, belastet sie den Kläger doch durch die zwangsläufige Reaktualisierung der ursprünglichen – unwahren – Tatsachenbehauptungen (s. dazu bereits oben II.2.a). Zugunsten des Klägers fällt insoweit erschwerend ins Gewicht, dass es sich bei dem Verdacht der Zuhälterei um einen schwerwiegenden Vorwurf handelt. (3) Entgegen der Auffassung der Revision wiegt das Schutzinteresse des Klägers nicht allein deshalb weniger schwer als das Veröffentlichungsinteresse der Beklagten, weil der streitgegenständlichen Gegendarstellung keine Breitenwirkung mehr zukomme. Nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Gegendarstellung zwar nicht ohne weiteres über eine Namenssuche bei der Suchmaschine von Google, wohl aber über die direkte Eingabe ihrer URL und über eine Namenssuche mittels der Suchfunktion auf der Webseite www.bild.de und damit weltweit auf der Seite eines bekannten Onlinemediums abrufbar. Sie ist damit – wenngleich weniger leicht – weiterhin für Dritte zugänglich. Die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des Klägers ist damit zwar deutlich weniger intensiv als bei einem prioritären Nachweis der Gegendarstellung über eine allgemeine Namenssuche mittels einer gängigen Suchmaschine …"
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 03. Juni 2020, Az. 1 BvR 1246/20, erneut zu den Anforderungen der prozessualen Waffengleichheit in presse-/äußerungsrechtlichen Eilverfahren entschieden und seine bisherige Rechtsprechung dazu bestätigt. insb stellt das BVerfG klar, dass eine prozessuale Einbeziehung der Gegenseite nur dann gleichwertig durch eine vorprozessuale Abmahnung ersetzt werden kann, wenn Abmahnung und Verfügungsantrag identisch sind. Wenn der Verfügungsantrag auf das vorprozessuale Erwiderungsschreiben argumentativ repliziert, neue Anträge enthält oder nachträglich ergänzt oder klargestellt wird, ist das jedoch nicht der Fall. ... mehr Vgl. Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 44/2020 vom 5. Juni 2020: "Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat mit heute veröffentlichter einstweiliger Anordnung eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin außer Kraft gesetzt, die den Beschwerdeführer ohne vorherige Anhörung zur Unterlassung einer Äußerung verpflichtet hatte. Die Kammer bekräftigt mit der Entscheidung die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den grundrechtlichen Anforderungen, die sich aus der prozessualen Waffengleichheit in einstweiligen Verfügungsverfahren ergeben (vergleiche Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September 2018 – 1 BvR 1783/17). Sie hat erneut klargestellt, dass eine Einbeziehung der Gegenseite in das einstweilige Verfügungsverfahren grundsätzlich auch dann erforderlich ist, wenn wegen besonderer Dringlichkeit eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen darf. Zudem hat sie bekräftigt, dass eine prozessuale Einbeziehung der Gegenseite nur dann gleichwertig durch eine vorprozessuale Abmahnung ersetzt werden kann, wenn Abmahnung und Verfügungsantrag identisch sind. Wenn der Verfügungsantrag auf das vorprozessuale Erwiderungsschreiben argumentativ repliziert, neue Anträge enthält oder nachträglich ergänzt oder klargestellt wird, ist das nicht der Fall. Diesen Anforderungen wird das dem angegriffenen Beschluss vorausgehende Verfahren vor dem Landgericht Berlin offenkundig nicht gerecht."
Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, kann auch dann vorliegen, wenn unterschiedliche räumliche Vertriebswege betroffen sind.
Im konkreten Fall, einem Rechtsstreit zwischen einem Bio-Bauernhof und ein einem Online-Shop, die beide Müslimischungen anboten, bot der Kläger keine Lieferung an, listete seine Angebot jedoch zum Abholen auf seiner Website auf; der Beklagte hingegen Vertrieb die Waren über einen klassischen Onlineshop. Das OLG Frankfurt a.M. ging in seinem Beschluss vom 11.11.2021 (Az. 6 U 81/219) trotz dieses Unterschieds im Vertriebsweg davon aus, dass zwischen beiden Anbietren ein Wettbewerbsverhältnis besteht: ... mehr "Schließlich ist auch nicht maßgeblich, dass die Parteien völlig unterschiedliche Vertriebswege bedienen (Online-Versand bzw. E-Mail-Bestellung und Abholung am Hof). Die wettbewerbsrechtliche Anspruchsberechtigung hängt nicht vom Umfang und Zuschnitt der unternehmerischen Tätigkeit des Mitbewerbers ab. Auf die am 1.12.2021 in Kraft tretende Neufassung des § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG, die einen Vertrieb der maßgeblichen Waren in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich voraussetzt, kommt es im Streitfall nicht an. Zu Unrecht meint das Landgericht auch, die Parteien seien nicht auf demselben räumlichen Markt tätig. Insoweit genügt eine Überschneidung der Märkte. Die Antragsgegnerin bietet ihre Leistungen bundesweit im Online-Handel an, mithin auch in Stadt1, wo der Antragsteller seinen Hof betreibt."
Mit Urt. v. 6. Juni 2019,. Az. I ZR 150/19 – Der Novembermann, hat der BGH entscheiden, dass mehrere urheberrechtliche Abmahnungen gegen unterschiedliche Rechtsverletzer kostenrechtlich eine Angelegenheit i.S.v. § 15 Abs. 2 RVG darstellen und damit entsprechende Urteile des LG Hamburg in der Sache bestätigt. Bei entsprechenden Vielfach- und Massenabmahnungen hat der abmahnende Rechteinhaber daher nur einen Kostenersatzanspruch, die abgemahnte Rechtsverletzer schulden jeweils nur einen Bruchteil einer aus einem Gesamtstreitwert berechneten Geschäftsgebühr. Demnach stellen mehrere getrennte, im Wesentlichen aber gleichlautende und in engem zeitlichem Zusammenhang (hier: innerhalb von zwei Monaten) ausgesprochene Abmahnungen wegen des rechtswidrigen Vertriebs von Vervielfältigungsstücken derselben Werke eine Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG dar, und zwar auch dann, wenn sie gegen unterschiedliche, rechtlich oder wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen (auch unterschiedlicher Handelsstufen) oder Personen ausgesprochen wurden. ... mehr BGH, Urt. v. 6. Juni 2019, Az. I ZR 150/19 – Der Novembermann, Rz. 20 ff. (Hervorhebungen hier): "2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass sich der Anspruch der Klägerin auf Zahlung von Abmahnkosten der Höhe nach auf lediglich 341,56 € beläuft. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Gegenstandswert der Angelegenheit, die 42 Rechtsverletzungen betreffe, belaufe sich auf 15.000 € pro Verletzung, mithin 630.000 €. Von dem danach berechneten Anspruch auf eine 1,3-fache Geschäftsgebühr zuzüglich 20 € Auslagenpauschale in Höhe von 4.781,90 € habe die Beklagte 3/42, mithin 341,56 € zu tragen, da sie wegen dreier Titel abgemahnt worden sei. Soweit andere Adressaten der Abmahnungen bereits Abmahnkosten beglichen hätten, führe dies im Verhältnis der Parteien nicht zur Erfüllung, da insoweit keine Gesamtschuld bestehe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die gegenüber der Beklagten erfolgte Abmahnung mit den weiteren im Zeitraum von Dezember 2016 bis Januar 2017 ausgesprochenen Abmahnungen nur eine Angelegenheit rechtsanwaltlicher Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG darstellte. Nach dieser Vorschrift kann der Rechtsanwalt die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern. aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs betreffen weisungsgemäß erbrachte anwaltliche Leistungen in der Regel dieselbe Angelegenheit, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang besteht und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so weitgehend übereinstimmen, dass von einem einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit gesprochen werden kann (BGH, Urteil vom 26. Mai 2009 VI ZR 174/08, AfP 2009, 394 Rn. 23; Urteil vom 12. Juli 2011 VI ZR 214/10, NJW 2011, 3657 Rn. 22). Ein einheitlicher Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit kann grundsätzlich auch dann noch vorliegen, wenn der Anwalt zur Wahrnehmung der Rechte des Geschädigten verschiedene, in ihren Voraussetzungen voneinander abweichende Anspruchsgrundlagen zu prüfen oder mehrere getrennte Prüfungsaufgaben zu erfüllen hat. Denn unter einer Angelegenheit im gebührenrechtlichen Sinne ist das gesamte Geschäft zu verstehen, das der Rechtsanwalt für den Auftraggeber besorgen soll. Ihr Inhalt bestimmt den Rahmen, innerhalb dessen der Rechtsanwalt tätig wird. Die Angelegenheit ist von dem Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit abzugrenzen, der das konkrete Recht oder Rechtsverhältnis bezeichnet, auf das sich die anwaltliche Tätigkeit bezieht. Eine Angelegenheit kann durchaus mehrere Gegenstände umfassen. Für einen einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit reicht es grundsätzlich aus, wenn die verschiedenen Gegenstände in dem Sinn einheitlich vom Anwalt bearbeitet werden können, dass sie verfahrensrechtlich zusammengefasst oder in einem einheitlichen Vorgehen zum Beispiel in einem einheitlichen Abmahnschreiben geltend gemacht werden können. Ein innerer Zusammenhang zwischen den anwaltlichen Leistungen ist zu bejahen, wenn die verschiedenen Gegenstände bei objektiver Betrachtung und unter Berücksichtigung des mit der anwaltlichen Tätigkeit nach dem Inhalt des Auftrags erstrebten Erfolgs zusammengehören (BGH, Urteil vom 27. Juli 2010 VI ZR 261/09, AfP 2010, 469 Rn. 16; Urteil vom 1. März 2011 – VI ZR 127/10, NJW 2011, 2591 Rn. 9; Urteil vom 22. Januar 2019 VI ZR 402/17, NJW 2019, 1522 Rn. 17, jeweils mwN). Eine Angelegenheit kann auch vorliegen, wenn ein dem Rechtsanwalt zunächst erteilter Auftrag vor dessen Beendigung später ergänzt wird. Ob eine Ergänzung des ursprünglichen Auftrags vorliegt oder ein neuer Auftrag erteilt wurde, ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls festzustellen (vgl. BGH, AfP 2010, 469 Rn. 22; BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 VI ZR 73/10, NJW 2011, 3167 Rn. 14; Mayer in Gerold/Schmidt, RVG, 23. Aufl., § 15 Rn. 8; Enders in Hartung/Schons/Enders, RVG, 3. Aufl., § 15 Rn. 38). bb) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe zu Unrecht einen einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit angenommen. (1) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin außer Betracht gelassen, nach dem sie ihren Prozessbevollmächtigten zu keiner Zeit einen einheitlichen universellen Auftrag erteilt habe, so dass die Annahme einer gebührenrechtlichen Angelegenheit nicht in Betracht komme. Die Revision verweist dabei auf das Vorbringen der Klägerin, ihren Prozessbevollmächtigten für jede einzelne Abmahnung individuell beauftragt zu haben. Die Klägerin hat hierzu weiter vorgetragen, zunächst seien mögliche Täter und deren Tathandlungen untersucht worden. Im Anschluss habe sich die Klägerin das von ihrem Prozessbevollmächtigten erbrachte Untersuchungsergebnis schildern lassen und jeweils entschieden, ob eine Abmahnung erfolgen solle oder nicht. (2) Das Berufungsgericht hat den Tatsachenvortrag der Klägerin in revisionsrechtlich beanstandungsfreier Weise dahingehend gewürdigt, dass im Streitfall angesichts eines sukzessiv erweiterten Auftrags ein einheitlicher Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit vorgelegen habe. Es hat hierbei insbesondere berücksichtigt, dass die Klägerin ihrem Vortrag zufolge die Prozessbevollmächtigten zunächst mit der Suche nach Tätern und Tathandlungen beauftragt und jeweils nach Darlegung der (neuen) Untersuchungsergebnisse über die Vornahme einer (weiteren) Abmahnung entschieden hat. Soweit die Revision darin eine Mehrzahl eigenständiger gebührenrechtlicher Angelegenheiten erblickt, nimmt sie lediglich eine von der tatrichterlichen Würdigung abweichende Bewertung des Tatsachenstoffs vor. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, dass die im Einzelfall von der Klägerin getroffenen Entscheidungen über die Vornahme weiterer Abmahnungen mit Blick auf den zuvor ihren Prozessbevollmächtigten erteilten Auftrag, eine Mehrzahl von Tätern und Rechtsverletzungen zu ermitteln, sich als sukzessiv erweiterter Auftrag im Rahmen eines einheitlichen Gesamtgeschehens darstellen. cc) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, im Streitfall bestehe zwischen den im Zeitraum von Dezember 2016 bis Januar 2017 erfolgten Abmahnungen verschiedener Anbieter von DVDs mit den streitgegenständlichen Werken eine hinreichende inhaltliche und zeitliche Verbindung, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern. (1) Die gegenüber verschiedenen Unternehmen und Personen von der Klägerin ausgesprochenen Abmahnungen hatten das gemeinsame Ziel, der rechtswidrigen Verbreitung von Vervielfältigungsstücken der drei Werke entgegenzuwirken, an denen sie ausschließliche Nutzungsrechte innehat. Die Abmahnungen knüpfen sämtlich an den Umstand an, dass der Lizenzvertrag mit Z. im September 2016 fristlos beendet worden war, beziehen sich in allen Fällen (jedenfalls) auf den Vertrieb von DVDs mit den drei genannten Filmwerken mit dem Schauspieler Götz George und sind innerhalb eines Zeitraums weniger Wochen erfolgt. (2) Die Revision macht weiterhin ohne Erfolg geltend, der Annahme eines einheitlichen Rahmens der anwaltlichen Tätigkeit stehe im Streitfall entgegen, dass die verschiedenen Gegenstände im Falle der gerichtlichen Geltendmachung aufgrund des unterschiedlichen Sitzes der zu verklagenden Unternehmen nicht in einem Verfahren erfolgen könne. Bei der Prüfung der Frage, ob ein außergerichtliches Vorgehen mit mehreren Gegenständen eine Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG darstellt, kommt es maßgeblich darauf an, ob der Rechtsanwalt diese Gegenstände aufgrund etwa der sachlichen und zeitlichen Verbundenheit mittels eines einheitlichen Vorgehens bearbeiten kann (vgl. Mayer in Gerold/Schmidt aaO § 15 Rn. 10). Die gerichtliche Zuständigkeit für eine etwaige, erst später erfolgende Klageerhebung ist hierfür kein aussagekräftiges Kriterium."
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die gegenüber der Beklagten erfolgte Abmahnung stelle mit zehn weiteren im Dezember 2016 und Januar 2017 ausgesprochenen Abmahnungen nur eine Angelegenheit rechtsanwaltlicher Tätigkeit dar, so dass die Klägerin die Gebühr in dieser Angelegenheit nur einmal fordern könne. Diese Abmahnungen seien darauf gerichtet gewesen, den rechtswidrigen Vertrieb derselben Werke zu unterbinden. In allen Abmahnungen werde auf die Kündigung der Lizenzverträge mit Z. abgestellt und verlangt, die Verbreitung der Werke zu unterlassen. Die Schreiben seien weitgehend identisch formuliert. Sie stünden auch in einem engen zeitlichen Zusammenhang. Der Annahme einer gebührenrechtlichen Angelegenheit stehe nicht entgegen, dass die abgemahnten Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich nicht verbunden seien. Die Abmahnungen würden zu einer Angelegenheit verklammert, weil in allen Schreiben die Verbreitung der Werke "Der Novembermann" und "Meine fremde Tochter" abgemahnt werde und Hauptdarsteller in allen drei Filmen Götz George sei. An sämtlichen betroffenen Werken habe die Klägerin Nutzungsrechte inne. Einzubeziehen seien auch die Abmahnungen an L. und B. Versandwerk, auch wenn diese DVDs nicht an Endkunden vertrieben hätten. Nicht zu derselben gebührenrechtlichen Angelegenheit zählten wegen des fehlenden zeitlichen Zusammenhangs lediglich die beiden im August 2016 und September 2017 vorgenommenen Abmahnungen.
Der verfahrensrechtliche Zusammenhang wird nicht dadurch gesprengt, dass bei einem außergerichtlichen Vorgehen gegen verschiedene Rechtsverletzer an jeden Adressaten ein eigenes Abmahnschreiben zu richten ist. Dies gilt insbesondere bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegenüber Rechtsverletzern, denen eine gleichgerichtete Verletzungshandlung vorzuwerfen ist, so dass die erforderlichen Abmahnungen einen identischen oder zumindest weitgehend identischen Inhalt haben (vgl. BGH, AfP 2010, 469 Rn. 17; NJW 2019, 1522 Rn. 18, jeweils mwN; OLG Düsseldorf, JurBüro 1982, 1508 f.). Eine wirtschaftliche oder rechtliche Verbundenheit der abgemahnten Unternehmen ist in einer solchen Fallgestaltung nicht erforderlich. Im Streitfall handelt es sich, wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, um gleichartige Rechtsverstöße, weil jeweils die Verbreitung von Vervielfältigungsstücken derselben Werke durch Vertriebsunternehmen durch im Wesentlichen gleichlautende Abmahnungen beanstandet wurden.
Zu Recht hat das Landgericht auch eine hinreichende Gleichförmigkeit der Rechtsverstöße mit Blick auf die Abmahnungen gegenüber den Unternehmen L. und B. Versandwerk angenommen, weil hier zwar nicht der Vertrieb gegenüber Endkunden, jedoch diesem vorgelagerte Vertriebsstufen betroffen waren. Handelt es sich um gleichgerichtete Verletzungshandlungen mehrerer Schädiger, deren Verantwortlichkeit aufgrund unterschiedlicher Tatbeiträge getrennt zu prüfen ist, so mag es sich um unterschiedliche Gegenstände handeln; innerhalb einer gebührenrechtlichen Angelegenheit können jedoch auch mehrere Prüfungsaufgaben zu behandeln sein (vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 2010 VI ZR 152/09, NJW 2011, 782 Rn. 14; Glückstein, ZUM 2014, 165, 168).
Mit Urteil vom 09.03.2021 in der Rechtssache Rs. C-392/19 – VG Bild-Kunst ./. Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat der europäische Gerichtshof EuGH entschieden, dass das Einbetten (sog. Framing) von urheberrechtlich geschützten, auf einer anderen Website mit Zustimmung des Rechteinhabers frei zugänglich gemachten Werken, dann rechtswidrig (mit Art. 3 Abs. 1 der InfoSoc-Richtlinie 2001/29/EG unvereinbar) ist, wenn das Framing unter Umgehung von von dem Rechteinhaber veranlassten Schutzmaßnahmen gegen Framing erfolgt. ... mehr Mt Fragen des Framing und der öffentlichen Zugänglichmachung urheberrechtlich geschützter Werke musste sich der EuGH und der Bundesgerichtshof BGH in den letzen Jahren wiederholt befassen, vgl. z.B. hier. Das Urteil des EuGH finden Sie hier. Wenn Sie dazu Fragen habe, sprechen sie uns gerne an!
